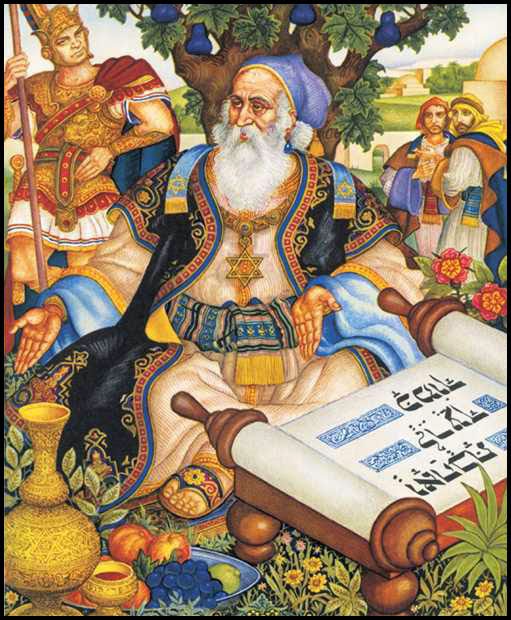ProMosaik e.V. im Gespräch mit Prof. Khallouk zum Frieden zwischen Muslimen und Juden
Liebe Leserinnen und Leser,
Prof. Khallouk kennen Sie wahrscheinlich schon aus unseren vorherigen Beiträgen.
Zum Nachlesen sehen Sie hier:
http://www.promosaik.com/mohammed-khallouk-in-deutschland-angekommen-marburg/
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/rezension-des-buches-von-prof-mohammed.html
Heute möchte ich Ihnen unser Interview über sein Buch “Salam, Jerusalem” vorstellen, in dem Prof. Khallouk von seiner Reise nach Israel und seinen positiven Erfahrungen des Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen spricht.
Er zeigt uns in seinem Reisetagebuch, wie man Vorurteile durch einen radikalen monotheistischen Humanismus überwindet.

Danke fürs Lesen und Teilen
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V.
Das Buch “Salam Jerusalem” wird noch in diesem Monat bei ProMosaik e.V. in italienischer Übersetzung erscheinen.
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für dich der radikale ethisch-monotheistische Humanismus,
der für mich das Ergebnis deiner Israel-Reise ist?
der für mich das Ergebnis deiner Israel-Reise ist?
Prof. Mohammed Khallouk: Die
Entscheidung, nach Israel zu reisen, ist mir keineswegs leicht gefallen. Die
Prägung durch mein Aufwachsen in einem muslimischen Land und die Berichte, die
ich von dort aus Medien vom israelisch-palästinensischen Konflikt aufnehmen
konnte, haben bei mir einen inneren Zwiespalt entstehen lassen. Einerseits war
ich durchaus neugierig, wie das Land des sogenannten „Erbfeindes“ in der
Realität aussieht, andererseits hatte ich immer Skrupel, diesem „Feind“
unmittelbar gegenübertreten zu müssen und habe die Entscheidung, dorthin zu
reisen, stets vor mir hergeschoben. Mein Leben in Deutschland und das
konfrontiert sein mit einer anderen „fremden“ Kultur hat mir jedoch eine neue
Sicht auf das Land und seine Menschen ermöglicht. Wie Levinas betonte,
ermöglicht erst die Ferne, die Dinge in neuem Licht zu sehen. Dies war auch bei
mir der Fall. Hinzu kamen die Erfahrungen mit jüdischen Intellektuellen wie
Shimon Levy, die mir geholfen haben, meine Skrupel soweit abzubauen, dass ich meinen
schon seit langem gefassten Entschluss, nach Israel zu reisen, in die Realität
umsetzen konnte.
Entscheidung, nach Israel zu reisen, ist mir keineswegs leicht gefallen. Die
Prägung durch mein Aufwachsen in einem muslimischen Land und die Berichte, die
ich von dort aus Medien vom israelisch-palästinensischen Konflikt aufnehmen
konnte, haben bei mir einen inneren Zwiespalt entstehen lassen. Einerseits war
ich durchaus neugierig, wie das Land des sogenannten „Erbfeindes“ in der
Realität aussieht, andererseits hatte ich immer Skrupel, diesem „Feind“
unmittelbar gegenübertreten zu müssen und habe die Entscheidung, dorthin zu
reisen, stets vor mir hergeschoben. Mein Leben in Deutschland und das
konfrontiert sein mit einer anderen „fremden“ Kultur hat mir jedoch eine neue
Sicht auf das Land und seine Menschen ermöglicht. Wie Levinas betonte,
ermöglicht erst die Ferne, die Dinge in neuem Licht zu sehen. Dies war auch bei
mir der Fall. Hinzu kamen die Erfahrungen mit jüdischen Intellektuellen wie
Shimon Levy, die mir geholfen haben, meine Skrupel soweit abzubauen, dass ich meinen
schon seit langem gefassten Entschluss, nach Israel zu reisen, in die Realität
umsetzen konnte.

Als
ich schließlich dort war und Juden wie Muslimen auf engstem Raum nebeneinander
leben und als Menschen mit Herz und Seele erfahren konnte, bin ich zu der
Überzeugung gelangt, dass unsere gemeinsame monotheistische Ethik uns durchaus
ermöglicht, uns gegenseitig Wertschätzung entgegenzubringen und in Eintracht miteinander
zu leben. Dass man sich gegenseitig als gleichwertige Menschen anerkennt mit
den gleichberechtigten Ansprüchen und Menschenrechten. Getragen ist diese Ethik
von dem Bewusstsein, dass alle Menschen gleichermaßen Geschöpfe des Einen
Gottes sind, der uns allen eine Verantwortung für unsere Mitmenschen gegeben
hat und für den jegliche äußeren Merkmale wie Rasse, Herkunft oder Konfession
dem allgemeinen Menschsein untergeordnet sind. In diesem Sinne hat für mich
auch der Satz Levinas „Der Mensch ist noch heiliger als jegliches Heilige Land“
für den Gegenübertritt zu Juden an den Heiligen Orten Jerusalems praktische
Bedeutung erlangt.
ich schließlich dort war und Juden wie Muslimen auf engstem Raum nebeneinander
leben und als Menschen mit Herz und Seele erfahren konnte, bin ich zu der
Überzeugung gelangt, dass unsere gemeinsame monotheistische Ethik uns durchaus
ermöglicht, uns gegenseitig Wertschätzung entgegenzubringen und in Eintracht miteinander
zu leben. Dass man sich gegenseitig als gleichwertige Menschen anerkennt mit
den gleichberechtigten Ansprüchen und Menschenrechten. Getragen ist diese Ethik
von dem Bewusstsein, dass alle Menschen gleichermaßen Geschöpfe des Einen
Gottes sind, der uns allen eine Verantwortung für unsere Mitmenschen gegeben
hat und für den jegliche äußeren Merkmale wie Rasse, Herkunft oder Konfession
dem allgemeinen Menschsein untergeordnet sind. In diesem Sinne hat für mich
auch der Satz Levinas „Der Mensch ist noch heiliger als jegliches Heilige Land“
für den Gegenübertritt zu Juden an den Heiligen Orten Jerusalems praktische
Bedeutung erlangt.

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was sollte der Friede für Juden und Muslime
heute in Nahost bedeuten?
Prof. Mohammed Khallouk: Ein
Friede sollte bedeuten, dass die Menschen trotz ihrer verschiedenen Religionen
eine gemeinsame Zukunft haben. Es sollten keine Skrupel mehr vor den Anderen
bestehen und man in der Lage sein, auf allen gesellschaftlichen Ebenen
ungehindert und frei von Zwängen zusammenzuarbeiten. So ein Frieden kann jedoch
nur entstehen, wenn die politischen Hindernisse dafür beseitigt werden und
beide Seiten das Bewusstsein besitzen, dass ihnen gegenüber Gerechtigkeit
geschehen ist. Gerechtigkeit bedeutet, dass die Beziehungen
zwischen Israelis und Palästinensern auf den Prinzipien des Völkerrechts
beruhen. Israel muss dafür anerkennen, dass die Palästinenser ein eigenes Volk
sind mit dem Recht auf einen eigenen Staat. Weiterhin verlangt es die seit 1967
besetzten Gebiete zu räumen und einen Staat Palästina mit Ostjerusalem als
Hauptstadt zuzugestehen. Ebenso erfordert es zumindest symbolisch die
Anerkennung des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge. Nicht zuletzt
verlangt es, keinen Neu- und Ausbau jüdischer Siedlungen in den besetzten
Gebieten und die Räumung der bereits bestehenden Siedlungen bzw. die Annahme
einer palästinensischen Staatsbürgerschaft durch die Siedler und ihre
Unterordnung unter palästinensisches Staatsrecht. Im Gegenzug sind die
Palästinenser und mit ihnen alle Muslime aufgerufen, Israel in den Grenzen von
1948 als jüdischen Staat anzuerkennen. Dazu gehört neben der Aufnahme
politisch-diplomatischer Beziehungen jegliche Einschränkungen im ökonomischen
und kulturellen Austausch aufzuheben. Letztlich sind auch die gegenseitig
auferlegten Reisebeschränkungen aufzuheben, so dass Israelis ebenso die
Einreise in arabische Staaten gewährleistet ist wie jeglichen Arabern und
Muslimen nach Israel.
Friede sollte bedeuten, dass die Menschen trotz ihrer verschiedenen Religionen
eine gemeinsame Zukunft haben. Es sollten keine Skrupel mehr vor den Anderen
bestehen und man in der Lage sein, auf allen gesellschaftlichen Ebenen
ungehindert und frei von Zwängen zusammenzuarbeiten. So ein Frieden kann jedoch
nur entstehen, wenn die politischen Hindernisse dafür beseitigt werden und
beide Seiten das Bewusstsein besitzen, dass ihnen gegenüber Gerechtigkeit
geschehen ist. Gerechtigkeit bedeutet, dass die Beziehungen
zwischen Israelis und Palästinensern auf den Prinzipien des Völkerrechts
beruhen. Israel muss dafür anerkennen, dass die Palästinenser ein eigenes Volk
sind mit dem Recht auf einen eigenen Staat. Weiterhin verlangt es die seit 1967
besetzten Gebiete zu räumen und einen Staat Palästina mit Ostjerusalem als
Hauptstadt zuzugestehen. Ebenso erfordert es zumindest symbolisch die
Anerkennung des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge. Nicht zuletzt
verlangt es, keinen Neu- und Ausbau jüdischer Siedlungen in den besetzten
Gebieten und die Räumung der bereits bestehenden Siedlungen bzw. die Annahme
einer palästinensischen Staatsbürgerschaft durch die Siedler und ihre
Unterordnung unter palästinensisches Staatsrecht. Im Gegenzug sind die
Palästinenser und mit ihnen alle Muslime aufgerufen, Israel in den Grenzen von
1948 als jüdischen Staat anzuerkennen. Dazu gehört neben der Aufnahme
politisch-diplomatischer Beziehungen jegliche Einschränkungen im ökonomischen
und kulturellen Austausch aufzuheben. Letztlich sind auch die gegenseitig
auferlegten Reisebeschränkungen aufzuheben, so dass Israelis ebenso die
Einreise in arabische Staaten gewährleistet ist wie jeglichen Arabern und
Muslimen nach Israel.

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist der interreligiöse Dialog
unter den “kleinen” Leuten in der Gesellschaft für den Frieden in
Nahost heute?
Prof. Mohammed Khallouk: Der
ist sehr wichtig, weil ein dauerhafter Frieden nur garantiert ist, wenn er auf
Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung trifft. Frieden kann nicht „von oben“
verordnet werden, sondern muss „von unten“ aus den Herzen der Menschen
erwachsen. Hinzu kommt, dass Israel ein weitgehend demokratisches Gemeinwesen
darstellt und die Palästinenser die Demokratie ebenfalls für sich beanspruchen.
In Demokratien werden Regierungen bzw. Parlamente von Mehrheiten (und somit von
den „kleinen“ Leuten) gewählt. Die politischen Verantwortungsträger können
somit letztlich nur Frieden schließen, wenn sie hierfür das Mandat ihres
Wahlvolkes besitzen. Zugleich sind die Eliten jedoch verpflichtet, dieses
Wahlvolk über die Vorteile und Erfordernisse eines nahöstlichen Friedens
aufzuklären. Leider nehmen die Eliten heutzutage ihre diesbezügliche
Verantwortung nicht oder nur unzureichend wahr. Wenn sich Feindbilder in den
Köpfen und Herzen beider Völker festgesetzt haben, so tragen die Eliten in
Politik und Medien dafür Verantwortung, weil sie die Menschen nicht über die
Anliegen und berechtigten Ansprüche des jeweils anderen Volkes aufklären,
sondern stattdessen jene, die sich mit legitimen Mitteln für ihre Interessen
einsetzen, allzu oft in der Öffentlichkeit als „Terroristen“
herabqualifizieren.
ist sehr wichtig, weil ein dauerhafter Frieden nur garantiert ist, wenn er auf
Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung trifft. Frieden kann nicht „von oben“
verordnet werden, sondern muss „von unten“ aus den Herzen der Menschen
erwachsen. Hinzu kommt, dass Israel ein weitgehend demokratisches Gemeinwesen
darstellt und die Palästinenser die Demokratie ebenfalls für sich beanspruchen.
In Demokratien werden Regierungen bzw. Parlamente von Mehrheiten (und somit von
den „kleinen“ Leuten) gewählt. Die politischen Verantwortungsträger können
somit letztlich nur Frieden schließen, wenn sie hierfür das Mandat ihres
Wahlvolkes besitzen. Zugleich sind die Eliten jedoch verpflichtet, dieses
Wahlvolk über die Vorteile und Erfordernisse eines nahöstlichen Friedens
aufzuklären. Leider nehmen die Eliten heutzutage ihre diesbezügliche
Verantwortung nicht oder nur unzureichend wahr. Wenn sich Feindbilder in den
Köpfen und Herzen beider Völker festgesetzt haben, so tragen die Eliten in
Politik und Medien dafür Verantwortung, weil sie die Menschen nicht über die
Anliegen und berechtigten Ansprüche des jeweils anderen Volkes aufklären,
sondern stattdessen jene, die sich mit legitimen Mitteln für ihre Interessen
einsetzen, allzu oft in der Öffentlichkeit als „Terroristen“
herabqualifizieren.

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet die Gerechtigkeit im Islam und
warum ist ein Frieden ohne Gerechtigkeit unmöglich?
Prof. Mohammed Khallouk: Es
wurde uns gelehrt, dass Gott eine gerechte Gemeinschaft beschützt, auch wenn
sie ungläubig ist und stattdessen eine ungerechte Gemeinschaft nicht beschützt,
auch wenn sie sich als muslimisch bezeichnet. Gerechtigkeit bedeutet im Islam,
dass jedem Menschen als Geschöpf Gottes gleichermaßen seine individuellen
Rechte zugestanden werden und der eine bzw. das eine Kollektiv nicht mehr
Rechte besitzt als andere. Wenn Muslime für sich Gerechtigkeit beanspruchen, sind
sie verpflichtet, diese Gerechtigkeit anderen Menschen gleichermaßen
zuzugestehen. Ein Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert, bleibt ein
„Papiertiger“, der bei den Menschen, die sich darin als ungerecht behandelt
fühlen, keine Akzeptanz findet. Sobald jene die Macht dazu besitzen, werden sie
wieder Gewalt anwenden, um die Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Die
Gerechtigkeit hat im Islam einen ungeheuer hohen Stellenwert, so dass Gott sich
uns Menschen gegenüber nur barmherzig zeigt, wenn wir gerecht handeln. Die
Barmherzigkeit kann im Islam vielmehr erst aus der Gerechtigkeit heraus
erfolgen.
wurde uns gelehrt, dass Gott eine gerechte Gemeinschaft beschützt, auch wenn
sie ungläubig ist und stattdessen eine ungerechte Gemeinschaft nicht beschützt,
auch wenn sie sich als muslimisch bezeichnet. Gerechtigkeit bedeutet im Islam,
dass jedem Menschen als Geschöpf Gottes gleichermaßen seine individuellen
Rechte zugestanden werden und der eine bzw. das eine Kollektiv nicht mehr
Rechte besitzt als andere. Wenn Muslime für sich Gerechtigkeit beanspruchen, sind
sie verpflichtet, diese Gerechtigkeit anderen Menschen gleichermaßen
zuzugestehen. Ein Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert, bleibt ein
„Papiertiger“, der bei den Menschen, die sich darin als ungerecht behandelt
fühlen, keine Akzeptanz findet. Sobald jene die Macht dazu besitzen, werden sie
wieder Gewalt anwenden, um die Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Die
Gerechtigkeit hat im Islam einen ungeheuer hohen Stellenwert, so dass Gott sich
uns Menschen gegenüber nur barmherzig zeigt, wenn wir gerecht handeln. Die
Barmherzigkeit kann im Islam vielmehr erst aus der Gerechtigkeit heraus
erfolgen.

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann der Satz von Simon Levy wegweisend
für die anderen Juden sein, die heute mit den Muslimen zusammenleben?
Prof. Mohammed Khallouk: Der
Satz Levys „Das Judentum ist meine Religion und der Islam ist meine Kultur“ ist
seiner lebenslangen Erfahrung des respektvollen Miteinanders und der
gegenseitigen Achtung von Juden und Muslimen in Marokko erwachsen. Im
islamischen Königreich in muslimischer Umgebung war es ihm nicht nur vergönnt,
ungehindert seine jüdische Religion zu praktizieren und den zivilen Bereich an
jüdischen Regeln auszurichten, vielmehr wurde er in einem fast ausschließlich
von Muslimen bewohnten Wahlkreis als Abgeordneter ins marokkanische Parlament
gewählt. Er besaß später sogar die Gelegenheit, in Casablanca das erste und
bislang einzige jüdische Museum mit staatlicher Unterstützung zu gründen und
konnte erleben, wie jüdische Friedhöfe und Kulturdenkmäler mit Geldern des
marokkanischen Staates erhalten wurden. Eine von islamischer Kultur geprägte
Gesellschaft war es letztlich, die ihm die Möglichkeit bot, die Geschichte des
Judentums mit seiner wissenschaftlichen Forschung für künftige Generationen
lebendig zu halten.
Satz Levys „Das Judentum ist meine Religion und der Islam ist meine Kultur“ ist
seiner lebenslangen Erfahrung des respektvollen Miteinanders und der
gegenseitigen Achtung von Juden und Muslimen in Marokko erwachsen. Im
islamischen Königreich in muslimischer Umgebung war es ihm nicht nur vergönnt,
ungehindert seine jüdische Religion zu praktizieren und den zivilen Bereich an
jüdischen Regeln auszurichten, vielmehr wurde er in einem fast ausschließlich
von Muslimen bewohnten Wahlkreis als Abgeordneter ins marokkanische Parlament
gewählt. Er besaß später sogar die Gelegenheit, in Casablanca das erste und
bislang einzige jüdische Museum mit staatlicher Unterstützung zu gründen und
konnte erleben, wie jüdische Friedhöfe und Kulturdenkmäler mit Geldern des
marokkanischen Staates erhalten wurden. Eine von islamischer Kultur geprägte
Gesellschaft war es letztlich, die ihm die Möglichkeit bot, die Geschichte des
Judentums mit seiner wissenschaftlichen Forschung für künftige Generationen
lebendig zu halten.
Der
Satz Levys sollte für alle Juden in muslimischer Umgebung als Motto dienen, die
es ihnen erlaubt, die Gesetze und Spielregeln der islamisch geprägten Kultur
als „eigene Normen“ anzuerkennen und gleichzeitig ihrem jüdischen Glauben
ungehindert treu zu bleiben. Ganz konkret könnte der Satz für diejenigen Juden
von Bedeutung sein, die in einem künftigen Staat Palästina als Minorität zu
leben bereit sind. Aber sogar für die jüdische Mehrheitsbevölkerung im Staat
Israel erlangt Levys Motto Relevanz, sofern sich dieser Staat – wie es der
frühere marokkanische König Hassan II. schon in den sechziger Jahren gefordert
hat- sich als Teil eines gemeinsamen nah- und mittelöstlichen Staatenbundes
versteht und der Arabischen Liga beitritt. Als Mitglied eines gemeinsamen
jüdisch-muslimischen Vorderen Orients gehörte man somit dem Islam als Kultur
an, das Judentum behielte man jedoch als Religion. Nicht zuletzt erlangt Levys
Satz auch für diejenigen Juden Bedeutung, die sich ihrer orientalischen Wurzeln
bewusst werden und vielleicht eines Tages aus der Emigration in Israel, Europa
oder Amerika beabsichtigen, in ihre arabisch-islamischen Ursprungsländer
zurückzukehren.
Satz Levys sollte für alle Juden in muslimischer Umgebung als Motto dienen, die
es ihnen erlaubt, die Gesetze und Spielregeln der islamisch geprägten Kultur
als „eigene Normen“ anzuerkennen und gleichzeitig ihrem jüdischen Glauben
ungehindert treu zu bleiben. Ganz konkret könnte der Satz für diejenigen Juden
von Bedeutung sein, die in einem künftigen Staat Palästina als Minorität zu
leben bereit sind. Aber sogar für die jüdische Mehrheitsbevölkerung im Staat
Israel erlangt Levys Motto Relevanz, sofern sich dieser Staat – wie es der
frühere marokkanische König Hassan II. schon in den sechziger Jahren gefordert
hat- sich als Teil eines gemeinsamen nah- und mittelöstlichen Staatenbundes
versteht und der Arabischen Liga beitritt. Als Mitglied eines gemeinsamen
jüdisch-muslimischen Vorderen Orients gehörte man somit dem Islam als Kultur
an, das Judentum behielte man jedoch als Religion. Nicht zuletzt erlangt Levys
Satz auch für diejenigen Juden Bedeutung, die sich ihrer orientalischen Wurzeln
bewusst werden und vielleicht eines Tages aus der Emigration in Israel, Europa
oder Amerika beabsichtigen, in ihre arabisch-islamischen Ursprungsländer
zurückzukehren.