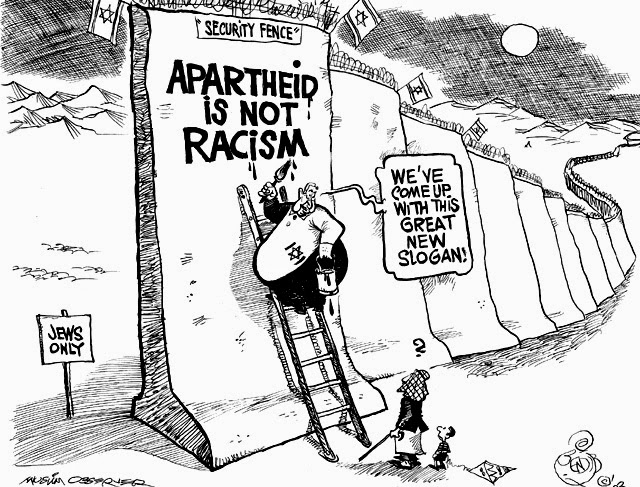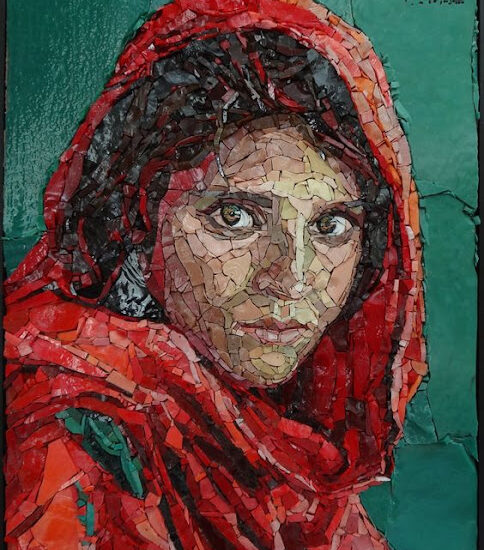Samantha Comizzoli: eine mutige Aktivistin aus Italien für Palästina
Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie bereits auf unserem Blog gesehen haben, haben wir
vor einigen Tagen die Rezension des Films von Simonetta Comizzoli „Israel, das
Geschwür“ unserer italienischen Kollegin Antonietta Chiodo veröffentlicht.
vor einigen Tagen die Rezension des Films von Simonetta Comizzoli „Israel, das
Geschwür“ unserer italienischen Kollegin Antonietta Chiodo veröffentlicht.
Wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview mit der Aktivistin Simonetta
Comizzoli über Palästina, die palästinensische Tragödie und das israelische
Regime, auch in deutscher Übersetzung vorzustellen. Die Worte der Aktivistin
sind, wie sie sehen, sehr hart. Sie lebt den palästinensischen Alltag im
Westjordanland und leidet hoffnungslos mit den Palästinensern mit. Auf die
Fragen, was sie unseren Leserinnen und Lesern sagen möchte, antwortet mir
Samantha: „RETTET UNS!“. Sie spricht von der absoluten Priorität der
Gerechtigkeit. Daher am Ende die Aussage: Ich bin nicht für den Frieden…
sondern für die Gerechtigkeit. Frau Comizzoli hat durch ihr Leben im
Westjordanland die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verloren…
Comizzoli über Palästina, die palästinensische Tragödie und das israelische
Regime, auch in deutscher Übersetzung vorzustellen. Die Worte der Aktivistin
sind, wie sie sehen, sehr hart. Sie lebt den palästinensischen Alltag im
Westjordanland und leidet hoffnungslos mit den Palästinensern mit. Auf die
Fragen, was sie unseren Leserinnen und Lesern sagen möchte, antwortet mir
Samantha: „RETTET UNS!“. Sie spricht von der absoluten Priorität der
Gerechtigkeit. Daher am Ende die Aussage: Ich bin nicht für den Frieden…
sondern für die Gerechtigkeit. Frau Comizzoli hat durch ihr Leben im
Westjordanland die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verloren…
Danke!
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.

Dr. phil. Milena
Rampoldi: Samantha, wie hast du deinen Weg nach Palästina gefunden? Wie hast du
angefangen, die palästinensische Tragödie wahrzunehmen und zu verstehen?
Rampoldi: Samantha, wie hast du deinen Weg nach Palästina gefunden? Wie hast du
angefangen, die palästinensische Tragödie wahrzunehmen und zu verstehen?
Samantha Comizzoli: Als Vittorio Arrigoni starb, habe ich
mich an das Thema Palästina herangewagt. Ich wusste schon von der israelischen
Besatzung, aber ich habe mich darüber gewundert, dass es zu dem Zeitpunkt noch
nicht diese große Reaktion gab, die ich mir eigentlich erwartet hatte. Kurz
darauf habe ich Paolo Barnard kontaktiert und eine Konferenz in Ravenna, wo ich
damals lebte, organisiert. Danach habe ich den Entschluss gefasst, nach
Palästina zu kommen. Die Tragödie zu verstehen, ist gar nicht so schwer: es
gibt die Unterdrücker, und es gibt die Unterdrückten.
mich an das Thema Palästina herangewagt. Ich wusste schon von der israelischen
Besatzung, aber ich habe mich darüber gewundert, dass es zu dem Zeitpunkt noch
nicht diese große Reaktion gab, die ich mir eigentlich erwartet hatte. Kurz
darauf habe ich Paolo Barnard kontaktiert und eine Konferenz in Ravenna, wo ich
damals lebte, organisiert. Danach habe ich den Entschluss gefasst, nach
Palästina zu kommen. Die Tragödie zu verstehen, ist gar nicht so schwer: es
gibt die Unterdrücker, und es gibt die Unterdrückten.

Dr. phil. Milena
Rampoldi: Welche waren die Menschen und die Bücher, die dir die Möglichkeit
geboten haben, die Bedeutung der Recherche und der „Entblößung“ der Wahrheit
über das israelische Regime zu verstehen?
Rampoldi: Welche waren die Menschen und die Bücher, die dir die Möglichkeit
geboten haben, die Bedeutung der Recherche und der „Entblößung“ der Wahrheit
über das israelische Regime zu verstehen?
Samantha Comizzoli: Das Buch des italienischen Journalisten
Paolo Barnard „Perché ci odiano“ (Warum sie uns hassen) und das Werk des
israelischen Historikers Ilan Pappè „Die ethnische Säuberung Palästinas”.
Paolo Barnard „Perché ci odiano“ (Warum sie uns hassen) und das Werk des
israelischen Historikers Ilan Pappè „Die ethnische Säuberung Palästinas”.
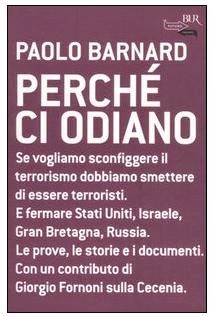
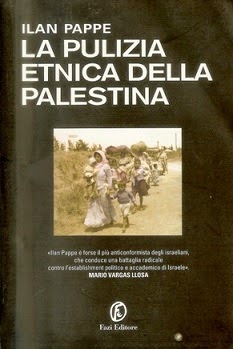
Dr. phil. Milena
Rampoldi: Was kann man heute in einem Land ohne Hoffnung machen, um für die
Hoffnung und den Frieden zu arbeiten?
Rampoldi: Was kann man heute in einem Land ohne Hoffnung machen, um für die
Hoffnung und den Frieden zu arbeiten?
Samantha Comizzoli: Israel hat das Maß schon vollgemacht und
sämtliche Grenzen schon doppelt und dreifach überschritten. Aber ich halte das
nicht aus. Ich kann nicht einfach da stehen und nichts tun gegen diesen
Völkermord. Somit kämpfe ich hoffnungslos bis zum Ende. Ich fordere gar nicht
mehr, dieses Naziregime zu stoppen. Denn ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass
die privilegierten Völker und die westlichen Länder dies jemals tun werden.
Denn sie tun es nicht mal für die Rechte, die sie selbst betreffen.
sämtliche Grenzen schon doppelt und dreifach überschritten. Aber ich halte das
nicht aus. Ich kann nicht einfach da stehen und nichts tun gegen diesen
Völkermord. Somit kämpfe ich hoffnungslos bis zum Ende. Ich fordere gar nicht
mehr, dieses Naziregime zu stoppen. Denn ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass
die privilegierten Völker und die westlichen Länder dies jemals tun werden.
Denn sie tun es nicht mal für die Rechte, die sie selbst betreffen.


Dr. phil. Milena
Rampoldi: Welche ist die wichtigste Botschaft dieses Dokumentarfilms?
Rampoldi: Welche ist die wichtigste Botschaft dieses Dokumentarfilms?
Samantha Comizzoli: Der psychische Schaden und das Streben
nach Befreiung vom Leid.
nach Befreiung vom Leid.


Dr. phil. Milena
Rampoldi: Was möchtest du den Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. im
deutschsprachigen Raum denn sagen?
Rampoldi: Was möchtest du den Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. im
deutschsprachigen Raum denn sagen?
Samantha Comizzoli: Rettet uns!!
Dr. phil. Milena
Rampoldi: Wie kann man zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterscheiden,
um sich heute für die Menschenrechte in Palästina einzusetzen?
Rampoldi: Wie kann man zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterscheiden,
um sich heute für die Menschenrechte in Palästina einzusetzen?
Samantha Comizzoli: Das palästinensische Volk ist semitisch
wie das jüdische. Der Zionismus wurde von laizistischen Sozialisten mit
Finanzierungen aus Russland gegründet. Er hat nichts mit der Religion zu tun.
Aber jenseits der historischen Rekonstruktion und der objektiven Wirklichkeit,
ist es sehr einfach, nicht in die von den Zionisten erfundene Falle des Antisemitismus
zu tappen. Für mich gilt nämlich: „Mitleid ist nicht selektiv. Denn wer Mitleid
verspürt, der hat Mitleid für alle, ohne Unterschied“.
wie das jüdische. Der Zionismus wurde von laizistischen Sozialisten mit
Finanzierungen aus Russland gegründet. Er hat nichts mit der Religion zu tun.
Aber jenseits der historischen Rekonstruktion und der objektiven Wirklichkeit,
ist es sehr einfach, nicht in die von den Zionisten erfundene Falle des Antisemitismus
zu tappen. Für mich gilt nämlich: „Mitleid ist nicht selektiv. Denn wer Mitleid
verspürt, der hat Mitleid für alle, ohne Unterschied“.


Dr. phil. Milena
Rampoldi: Bitte erzähle uns einen Tag einer palästinensischen Familie im
Westjordanland.
Rampoldi: Bitte erzähle uns einen Tag einer palästinensischen Familie im
Westjordanland.
Samantha Comizzoli: Der Tagesablauf einer palästinensischen
Familie variiert je nach dem Getto, zu dem die Familie gehört. Hier gibt es
keine Aufteilung nach politischen Parteien, sondern nach Dörfern,
Flüchtlingslagern, Städten; dann gibt es auch eine Aufteilung innerhalb der
Familien (da die Gesellschaft patriarchalisch aufgebaut ist). In diesen
Aufteilungen variiert der soziale Status auch sehr stark.
Familie variiert je nach dem Getto, zu dem die Familie gehört. Hier gibt es
keine Aufteilung nach politischen Parteien, sondern nach Dörfern,
Flüchtlingslagern, Städten; dann gibt es auch eine Aufteilung innerhalb der
Familien (da die Gesellschaft patriarchalisch aufgebaut ist). In diesen
Aufteilungen variiert der soziale Status auch sehr stark.
Im Allgemeinen sind die arbeitslosen Menschen im Bereich der
palästinensischen Behörde arm. Dies bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die
im Bereich der palästinensischen Behörde einen Job haben, nicht unter der
israelischen Besatzung leben. Denn auch sie müssen durch die Checkpoints.. mit
dem Unterschied, dass sie aber durchgelassen werden… die anderen, die in den
Flüchtlingslagern leben, kommen hingegen gar nicht durch. Man schießt auch auf
sie, ohne Fragen zu stellen. Diese letzteren machen aber die Mehrheit der
palästinensischen Bevölkerung aus. Der Tag für die Berufstätigen beginnt hier
sehr früh (so gegen 5 Uhr früh), denn um die nahen Städte zu erreichen, braucht
man Stunden über furchtbare Straßen, die sich durch die Hügel schlängeln, da
die Hauptstraße von Israel besetzt wurde, und es auf den schlechten Straßen so
viele Checkpoints gibt, die man überqueren muss. Die Ehemänner arbeiten den
ganzen Tag. Die Frauen bleiben zu Hause, erledigen die Hausarbeit und kümmern
sich um die Betreuung der Kinder. Gegen Sonnenuntergang ist der Tag zu Ende.
Man geht nicht aus dem Haus, weil es gefährlich ist. Es sind Soldaten und
israelische Siedler herum. Dann kommt die Nacht … und die Soldaten brechen
die Türen auf und dringen in die Häuser ein. Manchmal dringen sie ein,
zerstören alles, stehlen Geld und gehen dann wieder. In anderen Fällen
entführen sie Menschen. Anders ist wiederum die Situation derer, die in den
48-Gebieten arbeiten (die mit der Nakba von Israel besetzt wurden). Diese
Menschen gelangen so gegen 3 Uhr früh an den Checkpoint, um den Zugang zum
gestohlenen Land zu erhalten. Sie stehen Stunden lang Schlange, so ungefähr bis
6 Uhr morgens. Sie verbringen dort den Tag. Und wenn es dann 16 Uhr ist, kehren
sie auf diese Seite der Mauer zurück. Sie brauchen einige Stunden, um nach
Hause zu kommen, essen und schlafen einige wenige Stunden. All dies tun sie, um
genug Geld zu haben, um zu leben und ihre Familie ernähren zu können. Wer all
dies durchmacht, hat eine Genehmigung der israelischen Regierung, um in den
48-Gebieten zu arbeiten. Wenn sein Sohn beispielsweise verhaftet wird, wird ihm
die Genehmigung entzogen. Es gibt offiziell 200.000 Palästinenser, die in den
48-Gebieten arbeiten. Viermal so hoch die die Zahl der Palästinenser ohne Arbeitsgenehmigung,
die über die Mauer der Apartheid springen. Die Frauen haben ein Nicht-Leben,
das sie in den Häusern verbringen, in denen sie „warten“ und sich davor
fürchten, eine Nachricht zu erhalten, dass der eigene Sohn oder der eigene
Ehemann erschossen wurden. Die Familien, die für die palästinensische Behörde
arbeiten, haben wiederum ein völlig anderes Leben: der Großteil von ihnen
arbeitet in Ramallah. Den Transport dorthin übernimmt der Arbeitgeber. Sie sind
auch ein wenig freier und können Palästina verlassen, um nach Jordanien,
Ägypten, Saudi Arabien, usw. zu fahren. Ihre Kinder studieren normalerweise
einige Jahre im Ausland und arbeiten dann beispielsweise bei der
palästinensischen Polizei.
palästinensischen Behörde arm. Dies bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die
im Bereich der palästinensischen Behörde einen Job haben, nicht unter der
israelischen Besatzung leben. Denn auch sie müssen durch die Checkpoints.. mit
dem Unterschied, dass sie aber durchgelassen werden… die anderen, die in den
Flüchtlingslagern leben, kommen hingegen gar nicht durch. Man schießt auch auf
sie, ohne Fragen zu stellen. Diese letzteren machen aber die Mehrheit der
palästinensischen Bevölkerung aus. Der Tag für die Berufstätigen beginnt hier
sehr früh (so gegen 5 Uhr früh), denn um die nahen Städte zu erreichen, braucht
man Stunden über furchtbare Straßen, die sich durch die Hügel schlängeln, da
die Hauptstraße von Israel besetzt wurde, und es auf den schlechten Straßen so
viele Checkpoints gibt, die man überqueren muss. Die Ehemänner arbeiten den
ganzen Tag. Die Frauen bleiben zu Hause, erledigen die Hausarbeit und kümmern
sich um die Betreuung der Kinder. Gegen Sonnenuntergang ist der Tag zu Ende.
Man geht nicht aus dem Haus, weil es gefährlich ist. Es sind Soldaten und
israelische Siedler herum. Dann kommt die Nacht … und die Soldaten brechen
die Türen auf und dringen in die Häuser ein. Manchmal dringen sie ein,
zerstören alles, stehlen Geld und gehen dann wieder. In anderen Fällen
entführen sie Menschen. Anders ist wiederum die Situation derer, die in den
48-Gebieten arbeiten (die mit der Nakba von Israel besetzt wurden). Diese
Menschen gelangen so gegen 3 Uhr früh an den Checkpoint, um den Zugang zum
gestohlenen Land zu erhalten. Sie stehen Stunden lang Schlange, so ungefähr bis
6 Uhr morgens. Sie verbringen dort den Tag. Und wenn es dann 16 Uhr ist, kehren
sie auf diese Seite der Mauer zurück. Sie brauchen einige Stunden, um nach
Hause zu kommen, essen und schlafen einige wenige Stunden. All dies tun sie, um
genug Geld zu haben, um zu leben und ihre Familie ernähren zu können. Wer all
dies durchmacht, hat eine Genehmigung der israelischen Regierung, um in den
48-Gebieten zu arbeiten. Wenn sein Sohn beispielsweise verhaftet wird, wird ihm
die Genehmigung entzogen. Es gibt offiziell 200.000 Palästinenser, die in den
48-Gebieten arbeiten. Viermal so hoch die die Zahl der Palästinenser ohne Arbeitsgenehmigung,
die über die Mauer der Apartheid springen. Die Frauen haben ein Nicht-Leben,
das sie in den Häusern verbringen, in denen sie „warten“ und sich davor
fürchten, eine Nachricht zu erhalten, dass der eigene Sohn oder der eigene
Ehemann erschossen wurden. Die Familien, die für die palästinensische Behörde
arbeiten, haben wiederum ein völlig anderes Leben: der Großteil von ihnen
arbeitet in Ramallah. Den Transport dorthin übernimmt der Arbeitgeber. Sie sind
auch ein wenig freier und können Palästina verlassen, um nach Jordanien,
Ägypten, Saudi Arabien, usw. zu fahren. Ihre Kinder studieren normalerweise
einige Jahre im Ausland und arbeiten dann beispielsweise bei der
palästinensischen Polizei.
Ich bin nicht für den Frieden, ich bin für die Gerechtigkeit.