In Demokratien ist Gottes Wort verhandelbar
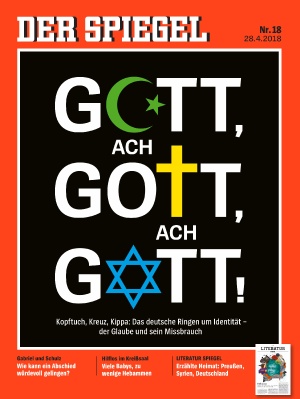
Von Jürgmeier, Infosperber, 29. Juni 2018. «Im Namen
Gottes des Allmächtigen!» So die Bundesverfassung. Aber in einem
pluralistischen Staat ist Gott kein gemeinsamer Nenner.
Gottes des Allmächtigen!» So die Bundesverfassung. Aber in einem
pluralistischen Staat ist Gott kein gemeinsamer Nenner.
Ich stelle mir vor, ein junger Mann klage gegen seine
Eltern. Weil sie ihn getauft. Zum Beispiel. Oder weil sie ihn beschnitten. Er
verwiese auf «das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit». Und darauf, dass die UNO-«Konvention über die Rechte des
Kindes» die Vertragsstaaten verpflichte, Kinder «vor jeder Form körperlicher
oder geistiger Gewaltanwendung» zu schützen. «Was würden Sie sagen», lasse ich
ihn den Richterinnen und Richtern zurufen, «wenn Eltern ihr zwei Wochen altes
Baby in die Schweizerische Volkspartei einschrieben oder einem
Säugling Hammer und Sichel auf den Hintern tätowieren liessen?» Kindsrechte
oder Religionsfreiheit – wie würde das Gericht entscheiden?
Eltern. Weil sie ihn getauft. Zum Beispiel. Oder weil sie ihn beschnitten. Er
verwiese auf «das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit». Und darauf, dass die UNO-«Konvention über die Rechte des
Kindes» die Vertragsstaaten verpflichte, Kinder «vor jeder Form körperlicher
oder geistiger Gewaltanwendung» zu schützen. «Was würden Sie sagen», lasse ich
ihn den Richterinnen und Richtern zurufen, «wenn Eltern ihr zwei Wochen altes
Baby in die Schweizerische Volkspartei einschrieben oder einem
Säugling Hammer und Sichel auf den Hintern tätowieren liessen?» Kindsrechte
oder Religionsfreiheit – wie würde das Gericht entscheiden?
«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu
lesen
oder
sonntags in die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen»
lesen
oder
sonntags in die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen»
In Dänemark muss das Parlament demnächst über eine
Petition abstimmen, welche «Beschneidungen bei Minderjährigen» verbieten will
(siehe «Beschneidung erst ab 18 Jahren: Juden und Moslems schockiert», Infosperber).
«Das Thema der Beschneidung», zitiert der Spiegel am
28. April 2018 Seth Kaplan von der Johns Hopkins University in Baltimore, sei
eine «Messlatte dafür», wie hoch westliche Gesellschaften die Religionsfreiheit
bewerten würden. Die Beschneidung sei seit Tausenden von Jahren «ein integraler
Bestandteil der kulturellen Identität und des religiösen Glaubens grosser Teile
der Welt. Die momentane Bewegung, sie im Westen abschaffen zu wollen, lässt
eine weitere Verengung der Bandbreite religiöser Freiheit erwarten.» Der
Kopenhagener Imam Waseem Hussain erklärt die Beschneidung zu einem «für die
Identität und das Zugehörigkeitsgefühl» zentralen Ritual. Sieht eine Tendenz,
«die Religionsfreiheit anderen Freiheiten zu unterstellen». Und befürchtet:
«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu lesen oder sonntags in
die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen» (Infosperber).
Petition abstimmen, welche «Beschneidungen bei Minderjährigen» verbieten will
(siehe «Beschneidung erst ab 18 Jahren: Juden und Moslems schockiert», Infosperber).
«Das Thema der Beschneidung», zitiert der Spiegel am
28. April 2018 Seth Kaplan von der Johns Hopkins University in Baltimore, sei
eine «Messlatte dafür», wie hoch westliche Gesellschaften die Religionsfreiheit
bewerten würden. Die Beschneidung sei seit Tausenden von Jahren «ein integraler
Bestandteil der kulturellen Identität und des religiösen Glaubens grosser Teile
der Welt. Die momentane Bewegung, sie im Westen abschaffen zu wollen, lässt
eine weitere Verengung der Bandbreite religiöser Freiheit erwarten.» Der
Kopenhagener Imam Waseem Hussain erklärt die Beschneidung zu einem «für die
Identität und das Zugehörigkeitsgefühl» zentralen Ritual. Sieht eine Tendenz,
«die Religionsfreiheit anderen Freiheiten zu unterstellen». Und befürchtet:
«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu lesen oder sonntags in
die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen» (Infosperber).
Da wird aus der Infragestellung einer konkreten – in
diesem Fall an Kleinkindern und folglich ohne deren Einverständnis vollzogenen
– rituellen Handlung eine pauschale Bedrohung konstruiert. Religionsfreiheit –
als Freiheit, sich zu einer selbst gewählten Religion oder Weltanschauung zu
bekennen und sie zu praktizieren – wird vermischt oder gar gleichgesetzt mit
dem (elterlichen) Recht, unmündigen Kindern eine Religion oder Weltanschauung
einzuschreiben sowie an ihnen die damit verbundenen Rituale vorzunehmen. Aber
die Religionsfreiheit der Eltern enthält nicht das Recht, die religiösen
Freiheiten ihrer Kinder wahrzunehmen. Die Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit des Kindes bedeutet ja explizit auch, andere Gedanken als die
eigenen Eltern zu haben, sich für eine andere (oder dieselbe) Religion
beziehungsweise Weltanschauung entscheiden zu können. Eltern können und dürfen
mit «ihren» Kindern nicht machen, was sie wollen.
diesem Fall an Kleinkindern und folglich ohne deren Einverständnis vollzogenen
– rituellen Handlung eine pauschale Bedrohung konstruiert. Religionsfreiheit –
als Freiheit, sich zu einer selbst gewählten Religion oder Weltanschauung zu
bekennen und sie zu praktizieren – wird vermischt oder gar gleichgesetzt mit
dem (elterlichen) Recht, unmündigen Kindern eine Religion oder Weltanschauung
einzuschreiben sowie an ihnen die damit verbundenen Rituale vorzunehmen. Aber
die Religionsfreiheit der Eltern enthält nicht das Recht, die religiösen
Freiheiten ihrer Kinder wahrzunehmen. Die Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit des Kindes bedeutet ja explizit auch, andere Gedanken als die
eigenen Eltern zu haben, sich für eine andere (oder dieselbe) Religion
beziehungsweise Weltanschauung entscheiden zu können. Eltern können und dürfen
mit «ihren» Kindern nicht machen, was sie wollen.
Die Abwehrreflexe Tradition und Identität
Der Verweis auf jahrhundertealte Traditionen
beziehungsweise kulturelle, religiöse oder regionale Identitäten ist ein
beliebter Abwehrreflex gegen Kritik, Einschränkung oder Überwindung bisheriger
Lehre und Praxis. Das gilt nicht nur für religiöse Gruppierungen.
Schützenvereine, beispielsweise, glauben eidgenössische Identitäten durch
schärfere Waffengesetze, aktuell EU-konforme Schuss-Magazine, bedroht. Einige
sehen die Identität der Welschschweiz zerfallen, sollte die Einfuhr von Foie
gras gestoppt werden. Da wird, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen teilweise
verständlicherweise, bei jeder Infragestellung tradierter Riten oder Praktiken
vorschnell «Wehret den Anfängen» gerufen. Die fast schon erpresserische
Drohung, in einem dadurch ins Antisemitische, Antiislamische, Antichristliche
oder ins generell Religionsfeindliche kippenden Land könnten Menschen ihren
Glauben nicht mehr leben, unterschlägt, dass es zur Entwicklung freiheitlicher
Gesellschaften gehört, immer wieder Traditionen, Weltbilder und bisherige
Identifikationen zu variieren oder zu überwinden. Das gilt für die Kirche, die
irgendwann das geozentrische Weltbild dem heliozentrischen opfern musste,
ebenso wie für die Appenzeller Männer (in Innerrhoden), denen das Bundesgericht
die ihnen, vermutlich, lieb gewordene Tradition, an der Landsgemeinde unter
sich zu sein, 1990 weggenommen hat. Trotzdem sind sie nicht ausgewandert (wohin
überhaupt?), sondern teilen sich seither geschwisterlich das Wort im Ring mit
den Innerrhödlerinnen.
beziehungsweise kulturelle, religiöse oder regionale Identitäten ist ein
beliebter Abwehrreflex gegen Kritik, Einschränkung oder Überwindung bisheriger
Lehre und Praxis. Das gilt nicht nur für religiöse Gruppierungen.
Schützenvereine, beispielsweise, glauben eidgenössische Identitäten durch
schärfere Waffengesetze, aktuell EU-konforme Schuss-Magazine, bedroht. Einige
sehen die Identität der Welschschweiz zerfallen, sollte die Einfuhr von Foie
gras gestoppt werden. Da wird, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen teilweise
verständlicherweise, bei jeder Infragestellung tradierter Riten oder Praktiken
vorschnell «Wehret den Anfängen» gerufen. Die fast schon erpresserische
Drohung, in einem dadurch ins Antisemitische, Antiislamische, Antichristliche
oder ins generell Religionsfeindliche kippenden Land könnten Menschen ihren
Glauben nicht mehr leben, unterschlägt, dass es zur Entwicklung freiheitlicher
Gesellschaften gehört, immer wieder Traditionen, Weltbilder und bisherige
Identifikationen zu variieren oder zu überwinden. Das gilt für die Kirche, die
irgendwann das geozentrische Weltbild dem heliozentrischen opfern musste,
ebenso wie für die Appenzeller Männer (in Innerrhoden), denen das Bundesgericht
die ihnen, vermutlich, lieb gewordene Tradition, an der Landsgemeinde unter
sich zu sein, 1990 weggenommen hat. Trotzdem sind sie nicht ausgewandert (wohin
überhaupt?), sondern teilen sich seither geschwisterlich das Wort im Ring mit
den Innerrhödlerinnen.
Kritik oder Einschränkung einzelner religiöser Praktiken
als Folge religionsübergreifender, allgemeiner Überlegungen sind keine
Religionsverbote. Wenn sich aber ein oder sogar ganzes Bündel von Verbot(en) –
wobei freiheitlich-demokratische Staaten generell nur da Verbote aussprechen
sollten, wo Rechte und Freiheiten anderer real gefährdet sind – ausschliesslich
gegen eine bestimmte Religion richtet, ist die Kritik berechtigt, hier werde
unter dem Deckmantel von Menschen- und Grundrechten eine bestimmte
Religionsgemeinschaft beziehungsweise ethnische Gruppierung ausgegrenzt,
unterdrückt und in letzter Konsequenz vertrieben.
als Folge religionsübergreifender, allgemeiner Überlegungen sind keine
Religionsverbote. Wenn sich aber ein oder sogar ganzes Bündel von Verbot(en) –
wobei freiheitlich-demokratische Staaten generell nur da Verbote aussprechen
sollten, wo Rechte und Freiheiten anderer real gefährdet sind – ausschliesslich
gegen eine bestimmte Religion richtet, ist die Kritik berechtigt, hier werde
unter dem Deckmantel von Menschen- und Grundrechten eine bestimmte
Religionsgemeinschaft beziehungsweise ethnische Gruppierung ausgegrenzt,
unterdrückt und in letzter Konsequenz vertrieben.
Konkret: Das spezifische Verbot von Minaretten, während
Kirchtürme stehen bleiben, ist anti-islamisch. Eine Lärm-Vorschrift aber die,
rein hypothetisch, am Dienstag von 08.00 bis 12.00h den Gebetsausruf, das
Läuten von Kirchenglocken, das Benutzen von Laubbläsern und Kettensägen, das
Autofahren und Fliegen verbietet, wäre weder anti-islamisch noch
anti-christlich, weder antisemitisch noch anti-religiös. Und wenn in einem
demokratischen Prozess – an dem auch die betroffenen Religionsgemeinschaften zu
beteiligen wären – Tierschutzgesetze erlassen würden, die, mit Blick auf einen
respektvollen Umgang mit Tieren, nur bestimmte Schlachtpraktiken zuliessen oder
das Schlachten generell verböten, könnten diese Gesetze nicht als gegen den
Glauben X gerichtet interpretiert werden, nur weil auch die zur Tradition und
Identität dieser Religionsgemeinschaft gehörende Form des Schlachtens betroffen
wäre.
Kirchtürme stehen bleiben, ist anti-islamisch. Eine Lärm-Vorschrift aber die,
rein hypothetisch, am Dienstag von 08.00 bis 12.00h den Gebetsausruf, das
Läuten von Kirchenglocken, das Benutzen von Laubbläsern und Kettensägen, das
Autofahren und Fliegen verbietet, wäre weder anti-islamisch noch
anti-christlich, weder antisemitisch noch anti-religiös. Und wenn in einem
demokratischen Prozess – an dem auch die betroffenen Religionsgemeinschaften zu
beteiligen wären – Tierschutzgesetze erlassen würden, die, mit Blick auf einen
respektvollen Umgang mit Tieren, nur bestimmte Schlachtpraktiken zuliessen oder
das Schlachten generell verböten, könnten diese Gesetze nicht als gegen den
Glauben X gerichtet interpretiert werden, nur weil auch die zur Tradition und
Identität dieser Religionsgemeinschaft gehörende Form des Schlachtens betroffen
wäre.
Gott ist kein gemeinsamer Nenner
Fortschreitende Erkenntnisprozesse sowie die
Veränderbarkeit von allem, inklusive Traditionen und Identitäten, sind zentrale
Elemente demokratischer, pluralistischer und multikultureller Gesellschaften.
Die damit verbundenen Integrationsprozesse können nur gelingen, wenn nicht die
einen (z.B. die Zuwandernden) den anderen (den Einheimischen) unterworfen
werden, sondern wenn sich alle bewegen. Das heisst: Echte Integration verändert
alle Beteiligten und ihre Kulturen. Um diese herausfordernden Prozesse zu
bewältigen, braucht es eine minimale gemeinsame Grundlage, das heisst einen
kleinsten gemeinsamen Nenner von Werten, (Verhandlungs-)Regeln und
Institutionen, mit denen sich die verschiedenen weltanschaulichen, kulturellen
und sozialen Gruppen identifizieren können. Gott – der auch Allah, Jahwe oder
welche «höhere Macht» auch immer sein kann – ist es in einer Welt von Gläubigen
und Ungläubigen ganz offensichtlich nicht.
Veränderbarkeit von allem, inklusive Traditionen und Identitäten, sind zentrale
Elemente demokratischer, pluralistischer und multikultureller Gesellschaften.
Die damit verbundenen Integrationsprozesse können nur gelingen, wenn nicht die
einen (z.B. die Zuwandernden) den anderen (den Einheimischen) unterworfen
werden, sondern wenn sich alle bewegen. Das heisst: Echte Integration verändert
alle Beteiligten und ihre Kulturen. Um diese herausfordernden Prozesse zu
bewältigen, braucht es eine minimale gemeinsame Grundlage, das heisst einen
kleinsten gemeinsamen Nenner von Werten, (Verhandlungs-)Regeln und
Institutionen, mit denen sich die verschiedenen weltanschaulichen, kulturellen
und sozialen Gruppen identifizieren können. Gott – der auch Allah, Jahwe oder
welche «höhere Macht» auch immer sein kann – ist es in einer Welt von Gläubigen
und Ungläubigen ganz offensichtlich nicht.
Das Gemeinsame muss jenseits des Grund-Dissenses zwischen
Gläubigen und Ungläubigen gesucht und gefunden werden. Und da bleiben nur die
von Menschen entwickelten Menschen- beziehungsweise Grundrechte sowie die demokratischen
Organisationen und rechtsstaatlichen Prozesse, denen in letzter Konsequenz auch
religiöse Visionen, Institutionen und Traditionen untergeordnet werden müssen.
Das ist für Religionen vermutlich eine bittere Kränkung. Denn sie neigen häufig
zur Bildung von «Parallelgesellschaften», in denen weltliche Gesetze nicht
gelten. «Wenn wir der Staat wären», argumentierte der Informationsbeauftragte
des katholischen Bistums Chur Giuseppe Gracia am 8. April 2016 in der Arena mit
Blick auf den Umgang mit der Gleichheit von Mann und Frau, «dann wäre es
Diskriminierung … Aber weil wir nicht der Staat sind, weil man frei austreten
kann …, ist das no problem» (siehe auch Infosperber).
Gläubigen und Ungläubigen gesucht und gefunden werden. Und da bleiben nur die
von Menschen entwickelten Menschen- beziehungsweise Grundrechte sowie die demokratischen
Organisationen und rechtsstaatlichen Prozesse, denen in letzter Konsequenz auch
religiöse Visionen, Institutionen und Traditionen untergeordnet werden müssen.
Das ist für Religionen vermutlich eine bittere Kränkung. Denn sie neigen häufig
zur Bildung von «Parallelgesellschaften», in denen weltliche Gesetze nicht
gelten. «Wenn wir der Staat wären», argumentierte der Informationsbeauftragte
des katholischen Bistums Chur Giuseppe Gracia am 8. April 2016 in der Arena mit
Blick auf den Umgang mit der Gleichheit von Mann und Frau, «dann wäre es
Diskriminierung … Aber weil wir nicht der Staat sind, weil man frei austreten
kann …, ist das no problem» (siehe auch Infosperber).
Das Primat von Menschenrechten und demokratisch
entwickelten Verfassungen ist eine zwingende Voraussetzung für erfolgreiche
Integration. Wo einzelne Grund- oder Menschenrechte miteinander in Konflikt
geraten – Religionsfreiheit beispielsweise ist so wenig ein pauschaler Freipass
wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit – muss dieser
durch demokratisch organisierte Prozesse und legitimierte Institutionen geklärt
werden. Damit werden Religionen – so schmerzlich das für jene sein mag, die
Gottes Wort als ewig gültiges empfinden – zu ganz gewöhnlichen
Weltanschauungsgemeinschaften wie Parteien, NGO-Organisationen, (Schützen-)Vereine
usw. Es gehört zwar zur Religionsfreiheit, dass Menschen an Götter glauben und
zu ihnen beten dürfen, aber in demokratischen Gesellschaften gilt das zwischen
Menschen ausgehandelte, nicht Gottes Wort, das Ungläubige für Menschenwort
halten.
entwickelten Verfassungen ist eine zwingende Voraussetzung für erfolgreiche
Integration. Wo einzelne Grund- oder Menschenrechte miteinander in Konflikt
geraten – Religionsfreiheit beispielsweise ist so wenig ein pauschaler Freipass
wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit – muss dieser
durch demokratisch organisierte Prozesse und legitimierte Institutionen geklärt
werden. Damit werden Religionen – so schmerzlich das für jene sein mag, die
Gottes Wort als ewig gültiges empfinden – zu ganz gewöhnlichen
Weltanschauungsgemeinschaften wie Parteien, NGO-Organisationen, (Schützen-)Vereine
usw. Es gehört zwar zur Religionsfreiheit, dass Menschen an Götter glauben und
zu ihnen beten dürfen, aber in demokratischen Gesellschaften gilt das zwischen
Menschen ausgehandelte, nicht Gottes Wort, das Ungläubige für Menschenwort
halten.
Das Urteil
Das zu Beginn angerufene weltliche und von mir nicht
wirklich unabhängige Gericht wird der Klage des jungen Mannes Recht geben, ohne
die Eltern zu einer Strafe zu verurteilen. Sie hätten, so die
Urteilsbegründung, in gutem Glauben gehandelt. Aber grundsätzlich seien
Kinderrechte künftig deutlich höher zu gewichten als bisher. Der Imam Waseem
Hussain mache zwar in Zusammenhang mit der Knabenbeschneidung zu Recht darauf
aufmerksam, Eltern würden «im Leben ihres Kindes auch fast alles andere
entscheiden» (Infosperber).
Die von ihm gestellte Frage «Wie viel Freiheit hat ein Kind überhaupt?» müsse
in Zukunft allerdings mit «möglichst viel» beantwortet werden. Das Gericht wird
darauf hinweisen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in Bezug auf Kinder,
alte Traditionen – beispielsweise die Prügelstrafe in der Schule – überwunden
worden seien. In einzelnen Ländern dürften auch Eltern ihre Kinder nicht mehr
schlagen.
wirklich unabhängige Gericht wird der Klage des jungen Mannes Recht geben, ohne
die Eltern zu einer Strafe zu verurteilen. Sie hätten, so die
Urteilsbegründung, in gutem Glauben gehandelt. Aber grundsätzlich seien
Kinderrechte künftig deutlich höher zu gewichten als bisher. Der Imam Waseem
Hussain mache zwar in Zusammenhang mit der Knabenbeschneidung zu Recht darauf
aufmerksam, Eltern würden «im Leben ihres Kindes auch fast alles andere
entscheiden» (Infosperber).
Die von ihm gestellte Frage «Wie viel Freiheit hat ein Kind überhaupt?» müsse
in Zukunft allerdings mit «möglichst viel» beantwortet werden. Das Gericht wird
darauf hinweisen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in Bezug auf Kinder,
alte Traditionen – beispielsweise die Prügelstrafe in der Schule – überwunden
worden seien. In einzelnen Ländern dürften auch Eltern ihre Kinder nicht mehr
schlagen.
Erziehende sollten grundsätzlich nur (Vor-)Entscheidungen
für Kinder treffen, wenn es unumgänglich und zu deren Schutz beziehungsweise
zur Entfaltung kindlichen Potenzials notwendig sei. Insbesondere aber sollten
sie keine die körperliche und psychische Integrität des Kindes tangierenden
Entscheidungen fällen, die zu einem späteren Zeitpunkt durch gegenteilige
Wünsche des inzwischen (religiös) erwachsen Gewordenen nicht mehr oder nur mit
schwerwiegenden Eingriffen rückgängig gemacht werden könnten.
für Kinder treffen, wenn es unumgänglich und zu deren Schutz beziehungsweise
zur Entfaltung kindlichen Potenzials notwendig sei. Insbesondere aber sollten
sie keine die körperliche und psychische Integrität des Kindes tangierenden
Entscheidungen fällen, die zu einem späteren Zeitpunkt durch gegenteilige
Wünsche des inzwischen (religiös) erwachsen Gewordenen nicht mehr oder nur mit
schwerwiegenden Eingriffen rückgängig gemacht werden könnten.
Bei der traditionellen Genitalverstümmelung von Mädchen,
wird das Gericht erläutern, gebe es inzwischen grosse Einigkeit darüber, dass
das Recht auf körperliche Unversehrtheit über die Religionsfreiheit zu stellen
sei. Deshalb sei sie – obwohl nach wie vor praktiziert – in den meisten Staaten
verboten. Die Beschneidung von Knaben sei zwar physisch mit der teilweisen oder
gänzlichen Entfernung der äusseren weiblichen Geschlechtsteile nicht
vergleichbar, trotzdem werde auch hier die Religionsfreiheit benutzt, um einem
Kleinkind – das, juristisch gesehen, weder urteils- noch handlungsfähig sei –
ungefragt eine religiöse Tradition im wörtlichen Sinne einzuschreiben. Dass
dieser Eingriff – der durchaus als leichte Körperverletzung interpretiert
werden könne – weniger Kritik auf sich ziehe als die weibliche
Genitalbeschneidung habe einerseits damit zu tun, dass letztere ungleich
brutaler sei, zum anderen spielten aber auch Geschlechterkonzepte eine Rolle.
Die Männlichkeits-Vorstellung «Ein Indianer, auch ein zwei Monate alter, kennt
keinen Schmerz» sei immer noch weit verbreitet.
wird das Gericht erläutern, gebe es inzwischen grosse Einigkeit darüber, dass
das Recht auf körperliche Unversehrtheit über die Religionsfreiheit zu stellen
sei. Deshalb sei sie – obwohl nach wie vor praktiziert – in den meisten Staaten
verboten. Die Beschneidung von Knaben sei zwar physisch mit der teilweisen oder
gänzlichen Entfernung der äusseren weiblichen Geschlechtsteile nicht
vergleichbar, trotzdem werde auch hier die Religionsfreiheit benutzt, um einem
Kleinkind – das, juristisch gesehen, weder urteils- noch handlungsfähig sei –
ungefragt eine religiöse Tradition im wörtlichen Sinne einzuschreiben. Dass
dieser Eingriff – der durchaus als leichte Körperverletzung interpretiert
werden könne – weniger Kritik auf sich ziehe als die weibliche
Genitalbeschneidung habe einerseits damit zu tun, dass letztere ungleich
brutaler sei, zum anderen spielten aber auch Geschlechterkonzepte eine Rolle.
Die Männlichkeits-Vorstellung «Ein Indianer, auch ein zwei Monate alter, kennt
keinen Schmerz» sei immer noch weit verbreitet.
Keine Zwangsrekrutierung von
Gläubigen
Gläubigen
Nebst solchen die Physis von Kleinkindern beschneidenden
Ritualen gebe es generell keinen hinreichenden Grund, bereits Kinder oder gar
Neugeborene in eine bestimmte Weltanschauungsgemeinschaft – und um eine solche
handle es sich auch bei Religionen – einzuordnen, es genüge, wenn Kinder und
Jugendliche im Laufe des Heranwachsens zu Hause, in der Schule und in anderen
gesellschaftlichen Bereichen mit unterschiedlichsten Glaubensformen und
Traditionen konfrontiert seien. Der pluralistische und demokratische Staat
müsse das Kind vor solchen Zugriffen schützen.
Ritualen gebe es generell keinen hinreichenden Grund, bereits Kinder oder gar
Neugeborene in eine bestimmte Weltanschauungsgemeinschaft – und um eine solche
handle es sich auch bei Religionen – einzuordnen, es genüge, wenn Kinder und
Jugendliche im Laufe des Heranwachsens zu Hause, in der Schule und in anderen
gesellschaftlichen Bereichen mit unterschiedlichsten Glaubensformen und
Traditionen konfrontiert seien. Der pluralistische und demokratische Staat
müsse das Kind vor solchen Zugriffen schützen.
Es sei sinnvoll, es den erwachsenen und handlungsfähigen
Menschen beziehungsweise den zunehmend urteilsfähiger werdenden Kindern zu
überlassen, welcher Religionsgemeinschaft oder Partei, welchem Verein oder Club
sie beitreten wollten oder nicht. Alle irgendwie weltanschaulichen
Gemeinschaften, wird eine der Richterinnen maliziös lächeln, hätten ja
hoffentlich genügend Vertrauen in die Attraktivität eigener Visionen, dass sie
nicht zur Zwangsrekrutierung wehrloser Kinder greifen müssten, um zu
Mitgliedern zu kommen.
Menschen beziehungsweise den zunehmend urteilsfähiger werdenden Kindern zu
überlassen, welcher Religionsgemeinschaft oder Partei, welchem Verein oder Club
sie beitreten wollten oder nicht. Alle irgendwie weltanschaulichen
Gemeinschaften, wird eine der Richterinnen maliziös lächeln, hätten ja
hoffentlich genügend Vertrauen in die Attraktivität eigener Visionen, dass sie
nicht zur Zwangsrekrutierung wehrloser Kinder greifen müssten, um zu
Mitgliedern zu kommen.
So stelle ich mir das zuweilen vor. Ohne allzu grosse
Hoffnungen. Galilei wurde schliesslich auch erst 1992 durch den damaligen Papst
Johannes Paul II. rehabilitiert, erst dann wurde offiziell eingestanden, «dass
nur die Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt war, … infrage kam» (www.lernhelfer.de).
Hoffnungen. Galilei wurde schliesslich auch erst 1992 durch den damaligen Papst
Johannes Paul II. rehabilitiert, erst dann wurde offiziell eingestanden, «dass
nur die Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt war, … infrage kam» (www.lernhelfer.de).


