Öffentliches Interesse ist wichtiger als private Gewinne
Von Public Eye, Untergrundblättle,
15. April 2020. Wer kriegt Zugang zu künftigen Covid-19-Behandlungen? Zum
Zeitpunkt, als wir diese Zeilen schreiben, gibt es weder eine spezifische
Behandlung für noch einen Impfstoff gegen Covid-19, das Coronavirus. Während an
verschiedenen Fronten unter Hochdruck geforscht wird, stellt sich eine
entscheidende Frage: Werden jene Produkte, die sich als wirksam erweisen, auf der
ganzen Welt verfügbar sein? Schaut man zurück auf frühere Pandemien und führt
sich die involvierten Parteien vor Augen, muss dies bezweifelt werden – obwohl
die Forschung massiv vom öffentlichen Sektor unterstützt wird. Doch es
existieren Lösungen, um eine faire Verteilung und bezahlbare Preise
sicherzustellen.
15. April 2020. Wer kriegt Zugang zu künftigen Covid-19-Behandlungen? Zum
Zeitpunkt, als wir diese Zeilen schreiben, gibt es weder eine spezifische
Behandlung für noch einen Impfstoff gegen Covid-19, das Coronavirus. Während an
verschiedenen Fronten unter Hochdruck geforscht wird, stellt sich eine
entscheidende Frage: Werden jene Produkte, die sich als wirksam erweisen, auf der
ganzen Welt verfügbar sein? Schaut man zurück auf frühere Pandemien und führt
sich die involvierten Parteien vor Augen, muss dies bezweifelt werden – obwohl
die Forschung massiv vom öffentlichen Sektor unterstützt wird. Doch es
existieren Lösungen, um eine faire Verteilung und bezahlbare Preise
sicherzustellen.
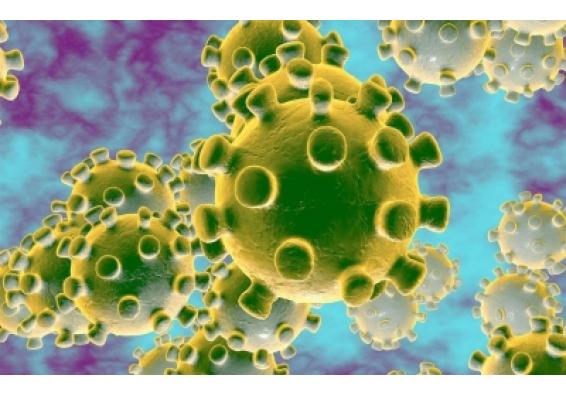
Im Juni 2009, als wegen der Schweinegrippe die Gefahr einer
Pandemie drohte und zwischen den Ländern ein Kampf um den nationalen Bedarf an
Impfstoffen geführt wurde, titelten wir im französischsprachigen
Mitgliedermagazin der damaligen Erklärung von Bern sinngemäss: «Wem gehört das
Grippevirus A(H1N1)?» Auch wenn sich die Covid-19- und die
Schweinegrippe-Pandemie in vielerlei Hinsicht unterscheiden, stellt sich heute
wieder eine ähnliche Frage: Wer wird einen fairen Zugang zu den Behandlungen
eines Virus’ garantieren, von dem mehr als 150 Länder betroffen sind?
Pandemie drohte und zwischen den Ländern ein Kampf um den nationalen Bedarf an
Impfstoffen geführt wurde, titelten wir im französischsprachigen
Mitgliedermagazin der damaligen Erklärung von Bern sinngemäss: «Wem gehört das
Grippevirus A(H1N1)?» Auch wenn sich die Covid-19- und die
Schweinegrippe-Pandemie in vielerlei Hinsicht unterscheiden, stellt sich heute
wieder eine ähnliche Frage: Wer wird einen fairen Zugang zu den Behandlungen
eines Virus’ garantieren, von dem mehr als 150 Länder betroffen sind?
Die erste Priorität liegt derzeit sinnvollerweise auf
Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Übertragung. Gleichzeitig werden
jedoch therapeutische und prophylaktische Massnahmen entwickelt. Es ist klar,
dass die zwangsläufig begrenzten Produktionskapazitäten zumindest anfangs nicht
den gesamten Bedarf werden decken können.
Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Übertragung. Gleichzeitig werden
jedoch therapeutische und prophylaktische Massnahmen entwickelt. Es ist klar,
dass die zwangsläufig begrenzten Produktionskapazitäten zumindest anfangs nicht
den gesamten Bedarf werden decken können.
Elf Jahre nach der Schweinegrippe verfügen wir jedoch über
Mechanismen, die es uns möglich machen, diese Situation besser anzugehen als
damals. Möglich ist das allerdings nur unter einer Bedingung: dass alle
Akteure, sowohl die Staaten wie auch die Pharmakonzerne, mitmachen!
Mechanismen, die es uns möglich machen, diese Situation besser anzugehen als
damals. Möglich ist das allerdings nur unter einer Bedingung: dass alle
Akteure, sowohl die Staaten wie auch die Pharmakonzerne, mitmachen!
Die Lehren aus Grippepandemien ziehen
2009 gab es angesichts der drohenden H1N1- oder
Schweinegrippe-Pandemie und aufgrund von Prognosen, dass die
Produktionskapazitäten nicht reichen würden, um den weltweiten Gesamtbedarf zu
decken, einen regelrechten Wettlauf um Impfstoffe. Die reichen Länder, darunter
auch die Schweiz, hatten bereits vorher ihre Lehren aus der Vogelgrippe H5N1
(2005–2007) gezogen und einen grossen Vorrat an antiviralen Medikamenten
angelegt. Erinnert sei an das berühmte Tamiflu von Roche, welches sich als für
die Behandlung dieser Grippeviren völlig ineffizient erweisen sollte, nachdem
es zu enormen – und letztlich unnötigen – öffentlichen Ausgaben geführt hatte.
Schweinegrippe-Pandemie und aufgrund von Prognosen, dass die
Produktionskapazitäten nicht reichen würden, um den weltweiten Gesamtbedarf zu
decken, einen regelrechten Wettlauf um Impfstoffe. Die reichen Länder, darunter
auch die Schweiz, hatten bereits vorher ihre Lehren aus der Vogelgrippe H5N1
(2005–2007) gezogen und einen grossen Vorrat an antiviralen Medikamenten
angelegt. Erinnert sei an das berühmte Tamiflu von Roche, welches sich als für
die Behandlung dieser Grippeviren völlig ineffizient erweisen sollte, nachdem
es zu enormen – und letztlich unnötigen – öffentlichen Ausgaben geführt hatte.
Diese Länder gaben 2009 nun Vorbestellungen bei den Herstellern
von H1N1-Impfstoffen (unter ihnen Novartis) auf, noch bevor diese überhaupt
zugelassen waren. Die Schweiz sicherte sich 13 Millionen Arzneimitteldosen, die
80 Prozent der Bevölkerung versorgen sollten – für insgesamt 84 Millionen
Franken. Angesichts eines absehbaren weltweiten Mangels schaute jedes Land nur
für sich, und für jene im Süden und Osten blieb kaum etwas bis gar nichts
übrig. Da sich die H1N1-Pandemie als weit weniger heftig als erwartet
herausstellte, hielten sich die Folgen dieses Egoismus glücklicherweise in
Grenzen.
von H1N1-Impfstoffen (unter ihnen Novartis) auf, noch bevor diese überhaupt
zugelassen waren. Die Schweiz sicherte sich 13 Millionen Arzneimitteldosen, die
80 Prozent der Bevölkerung versorgen sollten – für insgesamt 84 Millionen
Franken. Angesichts eines absehbaren weltweiten Mangels schaute jedes Land nur
für sich, und für jene im Süden und Osten blieb kaum etwas bis gar nichts
übrig. Da sich die H1N1-Pandemie als weit weniger heftig als erwartet
herausstellte, hielten sich die Folgen dieses Egoismus glücklicherweise in
Grenzen.
Zwar unterscheiden sich die Rahmenbedingungen für die
Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus stark von jenen bei der
Grippe, doch heute sind wieder ähnliche Verhaltensmuster zu erkennen. Man denke
nur an den Versuch von US-Präsident Donald Trump Anfang März, sich das deutsche
CureVac-Labor unter den Nagel zu reissen, um dem amerikanischen Markt den
exklusiven Zugang zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff zu sichern (siehe
Zweittext ab Seite 9). Trump wäre bereit gewesen, dafür eine Milliarde Dollar
aufzuwerfen, wenn die Aktion nicht von den aufgebrachten deutschen und
europäischen Behörden zum Scheitern gebracht worden wäre.
Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus stark von jenen bei der
Grippe, doch heute sind wieder ähnliche Verhaltensmuster zu erkennen. Man denke
nur an den Versuch von US-Präsident Donald Trump Anfang März, sich das deutsche
CureVac-Labor unter den Nagel zu reissen, um dem amerikanischen Markt den
exklusiven Zugang zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff zu sichern (siehe
Zweittext ab Seite 9). Trump wäre bereit gewesen, dafür eine Milliarde Dollar
aufzuwerfen, wenn die Aktion nicht von den aufgebrachten deutschen und
europäischen Behörden zum Scheitern gebracht worden wäre.
Die Frage der Bevorzugung bestimmter Nationen ist wieder
aktueller denn je und wird mit der Lancierung von zwangsläufig nur begrenzt
verfügbaren Covid-19-Behandlungen oder -Impfstoffen zusätzlich angefacht
werden. Deshalb müssen griffige und konzertierte Massnahmen getroffen werden,
um den Zugang für alle zu sichern und die Lehren aus früheren Krisen zu ziehen.
aktueller denn je und wird mit der Lancierung von zwangsläufig nur begrenzt
verfügbaren Covid-19-Behandlungen oder -Impfstoffen zusätzlich angefacht
werden. Deshalb müssen griffige und konzertierte Massnahmen getroffen werden,
um den Zugang für alle zu sichern und die Lehren aus früheren Krisen zu ziehen.
Wirksame Massnahmen für einen gleichen und fairen Zugang
Es ist enorm wichtig, jetzt rasch zu handeln, um gleichen
und fairen Zugang zu zukünftigen COVID-Behandlungen zu ermöglichen – unzählige
Menschenleben stehen auf dem Spiel. Wir zeigen hier einen Überblick über
bestehende Lösungen oder solche, die in Betracht gezogen werden sollten.
und fairen Zugang zu zukünftigen COVID-Behandlungen zu ermöglichen – unzählige
Menschenleben stehen auf dem Spiel. Wir zeigen hier einen Überblick über
bestehende Lösungen oder solche, die in Betracht gezogen werden sollten.
Den bestehenden internationalen Rahmen nutzen
Im Gegensatz zu 2009 verfügt die internationale Gemeinschaft
heute über einen internationalen Mechanismus, an dem sie sich orientieren kann:
den 2011 verabschiedeten Rahmen für die Vorbereitung auf eine
Influenza-Pandemie (englisch: Pandemic Influenza Preparedness oder kurz PIP)
der Weltgesundheitsorganisation WHO.
heute über einen internationalen Mechanismus, an dem sie sich orientieren kann:
den 2011 verabschiedeten Rahmen für die Vorbereitung auf eine
Influenza-Pandemie (englisch: Pandemic Influenza Preparedness oder kurz PIP)
der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Er soll durch die Festlegung klarer Regeln für den Austausch
von Viren mit Pandemiepotenzial sowie die Aufteilung des durch deren
Erforschung gewonnenen Nutzens eine bessere Reaktion auf solche Krisen
ermöglichen. Der Rahmen, der zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug
auf die Patentfrage zäh ausgehandelt wurde, sieht wenigstens ein Minimum der
Verteilung von Behandlungen oder Impfstoffen vor.
von Viren mit Pandemiepotenzial sowie die Aufteilung des durch deren
Erforschung gewonnenen Nutzens eine bessere Reaktion auf solche Krisen
ermöglichen. Der Rahmen, der zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug
auf die Patentfrage zäh ausgehandelt wurde, sieht wenigstens ein Minimum der
Verteilung von Behandlungen oder Impfstoffen vor.
Davor hatten die Pharmakonzerne völlig freien Zugang zum
Labornetz der WHO, das Virusstämme in Echtzeit austauschte. Die Konzerne,
darunter Novartis, nutzten dies aus, um Patente auf das virale Material
anzumelden, ohne den daraus gezogenen Nutzen zu teilen. Eine Praxis, die das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt als Biopiraterie qualifiziert. Als
die von der Vogelgrippe am stärksten betroffenen Länder, allen voran
Indonesien, merkten, dass sie kaum Zugang zu den Impfstoffen bekamen, die dank
des Austauschs «ihrer» Viren hatten entwickelt werden können, forderten sie von
der WHO strengere Regeln, die verhindern, dass die H5N1-Viren von den
Pharmakonzernen unrechtmässig und ohne Gegenleistung privatisiert werden
können.
Labornetz der WHO, das Virusstämme in Echtzeit austauschte. Die Konzerne,
darunter Novartis, nutzten dies aus, um Patente auf das virale Material
anzumelden, ohne den daraus gezogenen Nutzen zu teilen. Eine Praxis, die das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt als Biopiraterie qualifiziert. Als
die von der Vogelgrippe am stärksten betroffenen Länder, allen voran
Indonesien, merkten, dass sie kaum Zugang zu den Impfstoffen bekamen, die dank
des Austauschs «ihrer» Viren hatten entwickelt werden können, forderten sie von
der WHO strengere Regeln, die verhindern, dass die H5N1-Viren von den
Pharmakonzernen unrechtmässig und ohne Gegenleistung privatisiert werden
können.
Der PIP-Rahmen verpflichtet nun Akteure ausserhalb des
WHO-Netzes, für den Zugang zu den ausgetauschten Grippeviren einen finanziellen
Beitrag zu leisten. Bevor sie die Ressourcen nutzen können, müssen sie zudem
mit der WHO einen Vertrag aushandeln, der insbesondere Verpflichtungen
bezüglich der Aufteilung des Nutzens beinhaltet, der aus der Forschung
hervorgeht. Bisher wurden mit den grössten Herstellern 13 derartige Verträge
geschlossen, wodurch sich die WHO rund 420 Millionen Dosen Pandemie-Impfstoff –
viermal mehr, als sie 2009 erhielt – sowie 10 Millionen Packungen antiviraler
Behandlungen gesichert hat. Die finanziellen Beiträge beliefen sich bis Ende
Dezember 2019 auf rund 200 Millionen Dollar. Mit diesem Betrag konnten die
Pandemievorsorgemassnahmen in weniger gut gerüsteten Ländern verstärkt und das
WHO-Netz zum Austausch von Grippeviren mitfinanziert werden.
WHO-Netzes, für den Zugang zu den ausgetauschten Grippeviren einen finanziellen
Beitrag zu leisten. Bevor sie die Ressourcen nutzen können, müssen sie zudem
mit der WHO einen Vertrag aushandeln, der insbesondere Verpflichtungen
bezüglich der Aufteilung des Nutzens beinhaltet, der aus der Forschung
hervorgeht. Bisher wurden mit den grössten Herstellern 13 derartige Verträge
geschlossen, wodurch sich die WHO rund 420 Millionen Dosen Pandemie-Impfstoff –
viermal mehr, als sie 2009 erhielt – sowie 10 Millionen Packungen antiviraler
Behandlungen gesichert hat. Die finanziellen Beiträge beliefen sich bis Ende
Dezember 2019 auf rund 200 Millionen Dollar. Mit diesem Betrag konnten die
Pandemievorsorgemassnahmen in weniger gut gerüsteten Ländern verstärkt und das
WHO-Netz zum Austausch von Grippeviren mitfinanziert werden.
Zwar gilt dieser Rahmen derzeit nur für Influenzaviren mit
Pandemiepotenzial, doch die WHO und die Staaten könnten dessen Modalitäten
durchaus auch auf die Covid-19-Pandemie anwenden. So könnte die internationale
Gemeinschaft beschliessen, dass die WHO einen Teil der von den
Pharmaunternehmen hergestellten Diagnosetests, Behandlungen und Impfstoffe für
Covid-19 an Länder vergibt, denen solche fehlen, oder dass sie Lizenzen für die
lokale Produktion erteilt.
Pandemiepotenzial, doch die WHO und die Staaten könnten dessen Modalitäten
durchaus auch auf die Covid-19-Pandemie anwenden. So könnte die internationale
Gemeinschaft beschliessen, dass die WHO einen Teil der von den
Pharmaunternehmen hergestellten Diagnosetests, Behandlungen und Impfstoffe für
Covid-19 an Länder vergibt, denen solche fehlen, oder dass sie Lizenzen für die
lokale Produktion erteilt.
Garantieren, dass sich öffentliche Investitionen auszahlen
Wenn es um den Zugang zu Medikamenten geht, ist die Frage
des Preises zentral. Den Staaten stehen mehrere Hebel zur Verfügung, um dafür
zu sorgen, dass künftige Covid-19-Behandlungen oder-Impfstoffe zu einem
erschwinglichen Preis vertrieben werden. Das beginnt damit, dass die Forschung
durch massive öffentliche Investitionen überhaupt erst ermöglicht wird.
des Preises zentral. Den Staaten stehen mehrere Hebel zur Verfügung, um dafür
zu sorgen, dass künftige Covid-19-Behandlungen oder-Impfstoffe zu einem
erschwinglichen Preis vertrieben werden. Das beginnt damit, dass die Forschung
durch massive öffentliche Investitionen überhaupt erst ermöglicht wird.
Die US-Regierung hat seit der SARS-Krise 2003 mehr als 700
Millionen Dollar – mehr als jedes andere Land – in die Coronavirus-Forschung
investiert und finanziert weiterhin mehrere Projekte mit. Auch die EU hat
mehrere Millionen Euro in Covid-19 investiert: über ihr
Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 (von dem auch die Schweiz profitiert),
durch öffentlich-private Partnerschaften sowie mittels Darlehen der
Europäischen Investitionsbank – ganz zu schweigen von den umfassenden
nationalen Subventionen zur Unterstützung der Entwicklungsbemühungen. Die
Schweiz hat im Rahmen einer Ausschreibung für Coronavirus-Forschungsprojekte
über den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) fünf Millionen Franken zur
Verfügung gestellt – eine Premiere in dieser Form. Diesen öffentlichen
Finanzierungen ist es zu verdanken, dass Pharmaunternehmen Diagnosetests,
Behandlungen und Impfstoffe gegen Covid-19 entwickeln können.
Millionen Dollar – mehr als jedes andere Land – in die Coronavirus-Forschung
investiert und finanziert weiterhin mehrere Projekte mit. Auch die EU hat
mehrere Millionen Euro in Covid-19 investiert: über ihr
Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 (von dem auch die Schweiz profitiert),
durch öffentlich-private Partnerschaften sowie mittels Darlehen der
Europäischen Investitionsbank – ganz zu schweigen von den umfassenden
nationalen Subventionen zur Unterstützung der Entwicklungsbemühungen. Die
Schweiz hat im Rahmen einer Ausschreibung für Coronavirus-Forschungsprojekte
über den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) fünf Millionen Franken zur
Verfügung gestellt – eine Premiere in dieser Form. Diesen öffentlichen
Finanzierungen ist es zu verdanken, dass Pharmaunternehmen Diagnosetests,
Behandlungen und Impfstoffe gegen Covid-19 entwickeln können.
Doch die öffentlichen Investitionen sind an keinerlei
Bedingungen bezüglich des Endpreises geknüpft. Das Ergebnis: Die Öffentlichkeit
zahlt für die Forschung, die Pharmakonzerne melden Patente an und setzen ihre
Preise durch. Das bedeutet, dass die Bevölkerung gleich doppelt zur Kasse
gebeten wird: erst über die Steuern und dann für die Gewinnmargen der
Pharmakonzerne, die ihren Profit maximieren können, ohne darüber Rechenschaft
ablegen zu müssen.
Bedingungen bezüglich des Endpreises geknüpft. Das Ergebnis: Die Öffentlichkeit
zahlt für die Forschung, die Pharmakonzerne melden Patente an und setzen ihre
Preise durch. Das bedeutet, dass die Bevölkerung gleich doppelt zur Kasse
gebeten wird: erst über die Steuern und dann für die Gewinnmargen der
Pharmakonzerne, die ihren Profit maximieren können, ohne darüber Rechenschaft
ablegen zu müssen.
Die Covid-19-Technologien bündeln
Geht es um die Kommerzialisierung und den Preis von
Behandlungen oder Impfstoffen, stehen das sakrosankte geistige Eigentum und
sonstige kommerzielle Vorteile allzu oft über dem öffentlichen Interesse.
Angesichts des Ausmasses der gegenwärtigen Krise sind nun jedoch sogar aus dem
liberalen Lager Stimmen zu hören, dass die schädlichen Auswirkungen von
Patenten eingeschränkt werden müssen.
Behandlungen oder Impfstoffen, stehen das sakrosankte geistige Eigentum und
sonstige kommerzielle Vorteile allzu oft über dem öffentlichen Interesse.
Angesichts des Ausmasses der gegenwärtigen Krise sind nun jedoch sogar aus dem
liberalen Lager Stimmen zu hören, dass die schädlichen Auswirkungen von
Patenten eingeschränkt werden müssen.
Im Februar forderten 46 Abgeordnete des US-Kongresses die
Regierung auf, keine Exklusivlizenzen an Unternehmen zu erteilen, die
öffentlich finanzierte Covid-19-Behandlungen entwickeln. Denn damit würde ihnen
eine Monopolstellung gewährt, ohne dass sie im Gegenzug erschwingliche Preise
garantieren müssten.
Regierung auf, keine Exklusivlizenzen an Unternehmen zu erteilen, die
öffentlich finanzierte Covid-19-Behandlungen entwickeln. Denn damit würde ihnen
eine Monopolstellung gewährt, ohne dass sie im Gegenzug erschwingliche Preise
garantieren müssten.
Die Forderung blieb jedoch chancenlos. Die Pharmaindustrie
demonstrierte stattdessen ihre Lobbymacht im Rahmen der «pandemic bill» der
Trump-Administration, die Finanzmittel in der Höhe von über acht Milliarden
Dollar vorsieht (drei davon allein für Behandlungen oder Impfstoffe): Alle
verbindlichen Klauseln zum geistigen Eigentum oder zur Auferlegung einer Form
von Preiskontrolle wurden gestrichen. Die Botschaft ist klar: Die
Pharmakonzerne wollen sich absolute Handlungsfreiheit bewahren und jeden
Präzedenzfall vermeiden, der ihre Gewinnmargen schmälern könnte – globale Krise
hin oder her.
demonstrierte stattdessen ihre Lobbymacht im Rahmen der «pandemic bill» der
Trump-Administration, die Finanzmittel in der Höhe von über acht Milliarden
Dollar vorsieht (drei davon allein für Behandlungen oder Impfstoffe): Alle
verbindlichen Klauseln zum geistigen Eigentum oder zur Auferlegung einer Form
von Preiskontrolle wurden gestrichen. Die Botschaft ist klar: Die
Pharmakonzerne wollen sich absolute Handlungsfreiheit bewahren und jeden
Präzedenzfall vermeiden, der ihre Gewinnmargen schmälern könnte – globale Krise
hin oder her.
Dabei könnte man noch viel weiter gehen. Angesichts des
Ausmasses der Krise und des Umfangs der öffentlichen Finanzmittel, die für
deren Bewältigung aufgeworfen werden, wäre die beste Lösung für eine effiziente
globale Reaktion die Schaffung eines gemeinsamen Pools, in dem die Rechte an
allen Technologien zur Prävention, Erkennung und Behandlung von Covid-19 auf
WHO-Ebene gebündelt würden.
Ausmasses der Krise und des Umfangs der öffentlichen Finanzmittel, die für
deren Bewältigung aufgeworfen werden, wäre die beste Lösung für eine effiziente
globale Reaktion die Schaffung eines gemeinsamen Pools, in dem die Rechte an
allen Technologien zur Prävention, Erkennung und Behandlung von Covid-19 auf
WHO-Ebene gebündelt würden.
Durch einen solchen Mechanismus könnte weltweit ein fairer
Zugang zu und eine ausgewogene Verteilung von Diagnosetests, Medikamenten,
Impfstoffen und Ausrüstungen (Masken, Beatmungsgeräte usw.) sichergestellt
werden. Als eine Art Schnittstelle wäre die WHO befugt, die Rechte an geistigem
Eigentum (Lizenzen) und andere für die Produktion und den raschen Einsatz
dieser Technologien erforderliche Daten umzuverteilen. Damit könnte der
Behandlungs- und Impfstoffbedarf besser – und über einzelstaatliche Prioritäten
und die Gesetze der Kaufkraft hinaus – gedeckt werden.
Zugang zu und eine ausgewogene Verteilung von Diagnosetests, Medikamenten,
Impfstoffen und Ausrüstungen (Masken, Beatmungsgeräte usw.) sichergestellt
werden. Als eine Art Schnittstelle wäre die WHO befugt, die Rechte an geistigem
Eigentum (Lizenzen) und andere für die Produktion und den raschen Einsatz
dieser Technologien erforderliche Daten umzuverteilen. Damit könnte der
Behandlungs- und Impfstoffbedarf besser – und über einzelstaatliche Prioritäten
und die Gesetze der Kaufkraft hinaus – gedeckt werden.
Costa Rica hat bei der UN-Agentur einen formellen Antrag für
einen solchen Pool gestellt. Mehrere Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter
Public Eye, haben Ende März einen offenen Brief an die WHO und ihre
Mitgliedstaaten gesandt, in dem sie Costa Ricas Antrag unterstützen.
einen solchen Pool gestellt. Mehrere Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter
Public Eye, haben Ende März einen offenen Brief an die WHO und ihre
Mitgliedstaaten gesandt, in dem sie Costa Ricas Antrag unterstützen.
Wir fordern die sofortige Einrichtung eines solchen Pools,
bevor die ersten Behandlungen zugelassen werden – und der Verteilkampf beginnt.
bevor die ersten Behandlungen zugelassen werden – und der Verteilkampf beginnt.
Auf Zwangslizenzen gegen exzessive Preise zurückgreifen
Wenn alle oben genannten Mechanismen zur Umverteilung von
Behandlungen und Verhinderung von exorbitanten Preisen nicht ausreichen (oder
solange diese nicht umgesetzt sind), verfügen die Staaten immer noch über das
Mittel der Zwangslizenz für patentierte Medikamente. Mit diesem nach
internationalem Recht anerkannten Instrument können sie das Monopol auf ein
Arzneimittel vorübergehend aufheben, um dieses entweder selbst herzustellen
oder günstigere Generika zu importieren.
Behandlungen und Verhinderung von exorbitanten Preisen nicht ausreichen (oder
solange diese nicht umgesetzt sind), verfügen die Staaten immer noch über das
Mittel der Zwangslizenz für patentierte Medikamente. Mit diesem nach
internationalem Recht anerkannten Instrument können sie das Monopol auf ein
Arzneimittel vorübergehend aufheben, um dieses entweder selbst herzustellen
oder günstigere Generika zu importieren.
Im März haben Chile und Ecuador sowie, eher
überraschenderweise, auch G20-Länder wie Deutschland und Kanada erste
politische Schritte unternommen, um die Erteilung von Zwangslizenzen zu
erleichtern, falls sich die Diagnosetests, Behandlungen oder Impfstoffe für
Covid-19 als zu teuer oder knapp erweisen sollten.
überraschenderweise, auch G20-Länder wie Deutschland und Kanada erste
politische Schritte unternommen, um die Erteilung von Zwangslizenzen zu
erleichtern, falls sich die Diagnosetests, Behandlungen oder Impfstoffe für
Covid-19 als zu teuer oder knapp erweisen sollten.
Und Israel hat kürzlich erstmals damit gedroht, eine
Generikaversion des antiretroviralen Medikaments Kaletra des US-Konzerns AbbVie
einzuführen, das gegen Covid-19 wirksam sein könnte. Dies, obwohl Kaletra noch
bis 2024 unter Patentschutz steht. Dieses Vorgehen, das de facto einer
Zwangslizenz gleichkommt, zeigte sofortige Wirkung: Das amerikanische
Pharmaunternehmen erlaubte Israel die Einfuhr eines Generikums.
Generikaversion des antiretroviralen Medikaments Kaletra des US-Konzerns AbbVie
einzuführen, das gegen Covid-19 wirksam sein könnte. Dies, obwohl Kaletra noch
bis 2024 unter Patentschutz steht. Dieses Vorgehen, das de facto einer
Zwangslizenz gleichkommt, zeigte sofortige Wirkung: Das amerikanische
Pharmaunternehmen erlaubte Israel die Einfuhr eines Generikums.
Werden sich andere Länder von diesem Präzedenzfall
inspirieren lassen? Wird es eine Reihe von Zwangslizenzen im Zusammenhang mit
Covid-19-Behandlungen geben, allenfalls auch in reichen Ländern, die sich
bislang gegen dieses Instrument gewehrt haben? Das hängt in erster Linie von
der Bereitschaft der Pharmaindustrie ab, von sich aus für angemessene Preise
und eine faire Versorgung zu sorgen.
inspirieren lassen? Wird es eine Reihe von Zwangslizenzen im Zusammenhang mit
Covid-19-Behandlungen geben, allenfalls auch in reichen Ländern, die sich
bislang gegen dieses Instrument gewehrt haben? Das hängt in erster Linie von
der Bereitschaft der Pharmaindustrie ab, von sich aus für angemessene Preise
und eine faire Versorgung zu sorgen.
Anfang April forderte Public Eye Alain Berset in einem
offenen Brief auf, falls nötig Zwangslizenzen anzuwenden, um diesen Zugang zu
gewährleisten.
offenen Brief auf, falls nötig Zwangslizenzen anzuwenden, um diesen Zugang zu
gewährleisten.
Öffentliches Interesse ist wichtiger als private Gewinne
Die Corona-Krise führt uns auf brutale Art und Weise die
Defizite des aktuellen Innovationsmodells der Pharmaindustrie vor Augen;
angefangen bei den Forschungsprioritäten. Trotz nachdrücklicher Aufforderungen
vonseiten der Regierungen, die massiv in die Bekämpfung von Covid-19
investieren, hat die Big Pharma wenig Lust gezeigt, sich in der Erforschung und
Entwicklung neuer Behandlungen oder Impfstoffe zu engagieren. Der Bereich ist
schlicht nicht so profitabel wie jener der nicht übertragbaren Krankheiten wie
Krebs, wo hohe Gewinnmargen und eine lange Behandlungsdauer winken.
Defizite des aktuellen Innovationsmodells der Pharmaindustrie vor Augen;
angefangen bei den Forschungsprioritäten. Trotz nachdrücklicher Aufforderungen
vonseiten der Regierungen, die massiv in die Bekämpfung von Covid-19
investieren, hat die Big Pharma wenig Lust gezeigt, sich in der Erforschung und
Entwicklung neuer Behandlungen oder Impfstoffe zu engagieren. Der Bereich ist
schlicht nicht so profitabel wie jener der nicht übertragbaren Krankheiten wie
Krebs, wo hohe Gewinnmargen und eine lange Behandlungsdauer winken.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen lassen die Pharmariesen
kleinere Unternehmen die grössten Risiken auf sich nehmen. Sie wissen, dass sie
zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Spiel kommen werden, denn nur sie können
im grossen Stil produzieren. Der Schweizer Riese Novartis etwa ist an der
Forschung zu Covid-19 (abgesehen von Spenden) gar nicht beteiligt. Er hat seine
Impfstoffabteilung 2014 an die britische GSK verkauft und besitzt kein auf
antivirale Arzneimittel spezialisiertes Labor mehr. Der zweite Basler
Pharmamulti Roche ist etwas aktiver: Als einer der Marktführer im Bereich der
Diagnostik entwickelt er Covid-19 -Tests und hat sein Medikament Actemra bis zu
dessen Zulassung in gewissen Mengen zur Verfügung gestellt.
kleinere Unternehmen die grössten Risiken auf sich nehmen. Sie wissen, dass sie
zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Spiel kommen werden, denn nur sie können
im grossen Stil produzieren. Der Schweizer Riese Novartis etwa ist an der
Forschung zu Covid-19 (abgesehen von Spenden) gar nicht beteiligt. Er hat seine
Impfstoffabteilung 2014 an die britische GSK verkauft und besitzt kein auf
antivirale Arzneimittel spezialisiertes Labor mehr. Der zweite Basler
Pharmamulti Roche ist etwas aktiver: Als einer der Marktführer im Bereich der
Diagnostik entwickelt er Covid-19 -Tests und hat sein Medikament Actemra bis zu
dessen Zulassung in gewissen Mengen zur Verfügung gestellt.
Die Strategie hat sich bestens bewährt: Man wartet ab, bis
eine Behandlung erste Erfolge zeigt, bevor man ins Rennen einsteigt – und sich
die Rechercheergebnisse nachträglich notfalls mit Milliardenbeträgen sichert.
Diese Strategie ist nicht nur bei Covid-19 zu beobachten, sondern auch bei
seltenen Krankheiten oder Krebs.
eine Behandlung erste Erfolge zeigt, bevor man ins Rennen einsteigt – und sich
die Rechercheergebnisse nachträglich notfalls mit Milliardenbeträgen sichert.
Diese Strategie ist nicht nur bei Covid-19 zu beobachten, sondern auch bei
seltenen Krankheiten oder Krebs.
Das Problem ist grundsätzlicher Natur: Die
Prioritätensetzung der Pharmakonzerne wird in erster Linie von Monopolrechten
und Profitaussichten bestimmt – und nicht von den Bedürfnissen und Prioritäten
der öffentlichen Gesundheit.
Prioritätensetzung der Pharmakonzerne wird in erster Linie von Monopolrechten
und Profitaussichten bestimmt – und nicht von den Bedürfnissen und Prioritäten
der öffentlichen Gesundheit.
Wie, wenn nicht durch das Desinteresse der Pharmaindustrie
nach dem Abklingen der SARS-Krise, lässt sich erklären, dass wir heute –
siebzehn Jahre später – nicht einmal einen Prototyp eines
Coronavirus-Impfstoffs haben? Die US-Regierung hat zwar 700 Millionen Dollar in
diesen Bereich investiert, aber akademische Institute und Start-ups können
nicht alles alleine machen; das gilt besonders für die fortgeschrittenen
Testphasen und noch mehr für die Produktion selbst. Wir zahlen heute auch den
Preis dafür, dass sich die Staaten aus der Impfstoffproduktion zurückgezogen
haben: Sie müssen die Möglichkeit zurückerlangen, selbst Impfstoffe
herzustellen oder die Produktion zu konfiszieren, wenn die Situation es
erfordert.
nach dem Abklingen der SARS-Krise, lässt sich erklären, dass wir heute –
siebzehn Jahre später – nicht einmal einen Prototyp eines
Coronavirus-Impfstoffs haben? Die US-Regierung hat zwar 700 Millionen Dollar in
diesen Bereich investiert, aber akademische Institute und Start-ups können
nicht alles alleine machen; das gilt besonders für die fortgeschrittenen
Testphasen und noch mehr für die Produktion selbst. Wir zahlen heute auch den
Preis dafür, dass sich die Staaten aus der Impfstoffproduktion zurückgezogen
haben: Sie müssen die Möglichkeit zurückerlangen, selbst Impfstoffe
herzustellen oder die Produktion zu konfiszieren, wenn die Situation es
erfordert.
Das gilt bei weitem nicht nur für Covid-19. In den USA, dem
Land, das alleine 50 Prozent des globalen Pharmamarktes ausmacht, steckt die
Regierung jährlich etwa 40 Milliarden Dollar in Innovationen im
Gesundheitswesen – über 500 Milliarden in den letzten 20 Jahren. Die
öffentlichen Mittel haben zur Entwicklung von sämtlichen 210 neuen Medikamenten
beigetragen, die zwischen 2010 und 2016 in den USA zugelassen wurden, darunter
viele Krebsbehandlungen und Gentherapien für seltene Krankheiten.
Land, das alleine 50 Prozent des globalen Pharmamarktes ausmacht, steckt die
Regierung jährlich etwa 40 Milliarden Dollar in Innovationen im
Gesundheitswesen – über 500 Milliarden in den letzten 20 Jahren. Die
öffentlichen Mittel haben zur Entwicklung von sämtlichen 210 neuen Medikamenten
beigetragen, die zwischen 2010 und 2016 in den USA zugelassen wurden, darunter
viele Krebsbehandlungen und Gentherapien für seltene Krankheiten.
Ist das ein Problem? Ja, wenn man bedenkt, dass die
Pharmariesen ihre horrenden Preise mit den (in Tat und Wahrheit immer
geringeren) eingegangenen Risiken und den hohen Investitionen in Forschung und
Entwicklung rechtfertigen, obwohl die risikoreichsten Phasen eben oft von
anderen Akteuren und mithilfe öffentlicher Mittel durchgeführt werden.
Pharmariesen ihre horrenden Preise mit den (in Tat und Wahrheit immer
geringeren) eingegangenen Risiken und den hohen Investitionen in Forschung und
Entwicklung rechtfertigen, obwohl die risikoreichsten Phasen eben oft von
anderen Akteuren und mithilfe öffentlicher Mittel durchgeführt werden.
Da die Behandlungskosten hauptsächlich von den
Sozialversicherungen oder, wo solche nicht oder kaum existieren, von den
Patientinnen und Patienten selbst getragen werden, bezahlt die Gesellschaft für
das Gewinnstreben der Pharmakonzerne einen enormen Preis.
Sozialversicherungen oder, wo solche nicht oder kaum existieren, von den
Patientinnen und Patienten selbst getragen werden, bezahlt die Gesellschaft für
das Gewinnstreben der Pharmakonzerne einen enormen Preis.
Die Krise als Motor für einen Wandel
Die beispiellose Gesundheitskrise, die wir heute durchleben,
muss die verschiedenen Akteure veranlassen, das Innovationsmodell in der
Pharmaindustrie zu überdenken.
muss die verschiedenen Akteure veranlassen, das Innovationsmodell in der
Pharmaindustrie zu überdenken.
Die Regierungen leisten ihren Beitrag durch die Investition
von öffentlichen Geldern in die Forschung und Entwicklung neuer Behandlungen,
doch gleichzeitig müssen sie die Monopolstellung der Unternehmen einschränken,
um missbräuchliche Preise zu verhindern und den Zugang zu Behandlungen sicherzustellen.
Die Möglichkeiten dazu müssen genutzt und ausgeweitet werden, um ein besseres
Gleichgewicht zwischen privaten und gesellschaftlichen Interessen herzustellen.
von öffentlichen Geldern in die Forschung und Entwicklung neuer Behandlungen,
doch gleichzeitig müssen sie die Monopolstellung der Unternehmen einschränken,
um missbräuchliche Preise zu verhindern und den Zugang zu Behandlungen sicherzustellen.
Die Möglichkeiten dazu müssen genutzt und ausgeweitet werden, um ein besseres
Gleichgewicht zwischen privaten und gesellschaftlichen Interessen herzustellen.
Auch die Pharmaunternehmen müssen ihre Verantwortung
wahrnehmen und sich bemühen, alle Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit zu
berücksichtigen – und nicht nur diejenigen, die viel einbringen – sowie faire
und transparente Preise festzulegen, die den tatsächlichen Investitionen und
Risiken entsprechen.
wahrnehmen und sich bemühen, alle Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit zu
berücksichtigen – und nicht nur diejenigen, die viel einbringen – sowie faire
und transparente Preise festzulegen, die den tatsächlichen Investitionen und
Risiken entsprechen.
Bei einer Pressekonferenz des Weltpharmaverbands IFPMA zu
Covid-19-Therapien, die derzeit entwickelt werden, sagte Severin Schwan, der
CEO von Roche, es gehe jetzt nicht um Profitinteressen. Die Herausforderungen
seien die Produktionskapazitäten und der Zugang. Wir nehmen ihn beim Wort und
werden genau hinschauen, ob diese Prioritäten Bestand haben.
Covid-19-Therapien, die derzeit entwickelt werden, sagte Severin Schwan, der
CEO von Roche, es gehe jetzt nicht um Profitinteressen. Die Herausforderungen
seien die Produktionskapazitäten und der Zugang. Wir nehmen ihn beim Wort und
werden genau hinschauen, ob diese Prioritäten Bestand haben.
Unsere Empfehlungen angesichts der Covid-19-Krise – und
darüber hinaus:
darüber hinaus:
Eine gerechte Verteilung der medizinischen Technologien auf
globaler Ebene gemäss der für Grippepandemien geschaffenen Rahmenbestimmungen.
globaler Ebene gemäss der für Grippepandemien geschaffenen Rahmenbestimmungen.
Eine WHO, die befugt ist, die Rechte an geistigem Eigentum
sowie alle erforderlichen Daten für die Produktion und den Zugang zu
Covid-19-Technologien global umzuverteilen (mehr dazu in unserer
Medienmitteilung).
sowie alle erforderlichen Daten für die Produktion und den Zugang zu
Covid-19-Technologien global umzuverteilen (mehr dazu in unserer
Medienmitteilung).
Verträge über öffentliche Forschungsfinanzierung, die
Bedingungen bezüglich des Endpreises enthalten sowie
Interventionsmöglichkeiten, falls diese unerschwinglich sind.
Bedingungen bezüglich des Endpreises enthalten sowie
Interventionsmöglichkeiten, falls diese unerschwinglich sind.
Der Einsatz von Zwangslizenzen, wenn der Zugang zu
patentierten Produkten aufgrund unerschwinglicher Preise oder einer
unzureichenden Versorgung nicht gewährleistet ist.
patentierten Produkten aufgrund unerschwinglicher Preise oder einer
unzureichenden Versorgung nicht gewährleistet ist.
Eine Reform des Pharma-Innovationsmodells, um den
Prioritäten der öffentlichen Gesundheit besser gerecht zu werden.
Prioritäten der öffentlichen Gesundheit besser gerecht zu werden.


